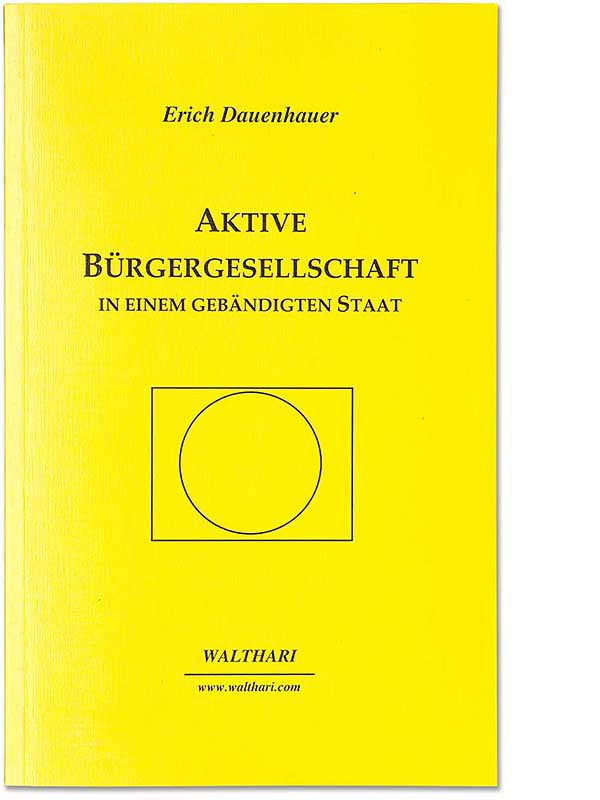Lebensphilosophie
Vom 29. Mai 2004
Wirtschaftsethische Selbstverpflichtung für Führungskräfte
Was der hippokratische Eid für Ärzte (niedergeschrieben etwa 400 v. Chr., in aktualisierter Fassung: vgl. Deutsches Ärzteblatt 1/2/94, S. B 39), das sollte eine wirtschaftsethische Selbstverpflichtung für Führungskräfte sein. Beiden Eliten ist ein jeweils hohes Gut anvertraut: bei Ärzten die Gesundheit und bei Managern die Wohlstandsbereitung. Führungskräfte sollten sich stets bewußt bleiben, daß es bei ihrer Aufgabenerfüllung nicht allein auf Leistungen, sondern auch auf moralische und kulturelle Standards ankommt, die zu mißachten schwere Schäden beim Einzelnen, bei der Betriebsgemeinschaft und auch in der Gesellschaft verursacht. Ein Managereid käme zudem einem persönlichen Qualitätssiegel gleich und besäße eine Ansporn- und Zähmungsfunktion zugleich. Angesichts des anhaltenden Ansehensverlustes von Managern wäre ein Verhaltenskodex, wie er im folgenden Eidestext zum Ausdruck kommt, für alle Seiten von unschätzbarem Wert: Er trägt letztlich zum sozialen Frieden bei und regt zum Vorbildverhalten an, so daß Unternehmenswohl und Gemeinwohl sich nicht fremd bleiben. Wenn Selbstverpflichtungen einmal zur Ehrensache geworden sind, erhält die Fortentwicklung von der reinen Leistungsgesellschaft zur solidarischen Kulturgemeinschaft eine wirkliche Chance. Bekanntlich sind Vertrauen, Motivation und Solidarität die wichtigsten Aktivposten in der betrieblichen Sozialkapital-Bilanz, die auf die Qualität der Arbeit einwirkt. In Zeiten zunehmender parteien- und staatsdirigistischer Eingriffe können moralisch integre Führungskräfte die bedrohten unternehmerischen Freiheiten besser verteidigen als ›Profitbosse‹, denen es an Glaubwürdigkeit gebricht. Ein hohes betriebliches und gesellschaftliches Ansehen der Führungskräfte läge schließlich in ihrem eigenen Interesse, mindert es doch die körperlichen und psychischen Belastungen, steigert die Arbeitsfreude u.v.m.
Manager-Eid
WALTHARI-Fassung (Dr. E. Dauenhauer)
§ 1 Generalklausel
§ 2 Oberste Handlungsziele
§ 3 Fordern und fördern
§ 4 Leistungs- und Unternehmenskultur
§ 5 Unternehmens- und Gemeinwohl
§ 6 Schonender Ressourcenverbrauch
§ 7 Ehrlicher Makler
Vom 15. Juni 2004
Hochherzigkeit
Zugleich eine Verteidigung des humanen Utilitarismus’
1 – Wortverwandtschaft. Mag auch Hochherzigkeit in der Moderne zum seltenen Wortgänger geworden sein (weil die Gesinnung dafür dünn geworden ist), in der zweieinhalbtausendjährigen Tugendlehre stand sie zumeist in hohem Ansehen und in nächster Verwandtschaft zu Hochgesinntheit, Hochsinn, Hochgemutheit, Großmut, Seelengröße, Freigebigkeit, Großzügigkeit, Edelmut und Generosität. Hinter dieser Wortfamilie halten sich neben Weitsicht, Zuneigung und einem reinen und weiten Herzen auch soziale Tapferkeit und Zutrauen verborgen. Wer hochherzig denkt und handelt, will den besseren oder zumindest den sich bessernden Mitmenschen, dem er fast alles verzeiht, außer (so Baltasar Graciàn, in: ›Der kluge Weltmann‹) Gemeinheit und Schändlichkeit, »denn Schandmale lassen sich durch keinen Kunstgriff beseitigen«.
2 – In der Tugendlehre macht die Hochherzigkeit (Megalopsychia) seit der ›Nikomachischen Ethik‹ des Aristoteles eine moralische Karriere. Der Platonschüler rechnet sie zur Idealform menschlichen Verhaltens und sieht sie in Gesellschaft zum Ehrgeiz auf Ehre (!), zur Freigebigkeit und Großzügigkeit. Die Megalopsychia justiere den Menschen auf die rechte Mitte zwischen Aufgeblasenheit und Kleinmut (Mikropsychia). Der Megalopsychos sei mutig, gerecht und erstrebe das Große und Hohe. Als Tugend setze Hochherzigkeit andere Tugenden voraus und schmücke deren Vollendung. – Auch die Stoa sieht die Magnanimitas im Verbund mit Tapferkeit und Hochsinn (magnitudo animi), was von Cicero fortgeschrieben wird: Bei ihm rangiert die Magnanimitas sogar unter den vier Kardinaltugenden; er verbindet sie mit Tapferkeit (fortiutudo), Standhaftigkeit (constantia), Geduld (patientia) und Nachsicht (indulgentia; in: ›De officio‹, I, 152). – Mit Thomas von Aquin nimmt Hochherzigkeit eine Sinnwendung zur christlichen Nächstenliebe und zur Gnadenabhängigkeit des Menschen (in: ›Summa theologica‹, II). …
Weiterführende Literatur: Weisheitliche Lebensführung
Die Textergänzung zu diesem Artikel kann bei WALTHARI, Postfach 100019, 66979 Münchweiler gegen eine geringe Gebühr bezogen werden.
Schopenhauers Höhle
»Der geistreiche Mensch wird vor allem nach Schmerzlosigkeit, Ungehudeltsein, Ruhe und Muße streben, folglich ein stilles, bescheidenes, aber möglichst unangefochtenes Leben suchen und demgemäß, nach einiger Bekanntschaft mit den sogenannten Menschen, die Zurückgezogenheit und, bei großem Geiste, sogar die Einsamkeit wählen. Denn je mehr einer an sich selber hat, desto weniger bedarf er von außen und desto weniger auch können die übrigen ihm sein. Darum führt die Eminenz des Geistes zur Ungeselligkeit. Ja, wenn die Qualität der Gesellschaft sich durch die Quantität ersetzen ließe; da wäre es der Mühe wert, sogar in der großen Welt zu leben: aber leider geben hundert Narren, auf einen Haufen, noch keinen gescheiten Mann.«
Phronesis
Auch die weisesten Weisen sind nicht höhlenbeständig. Es treibt sie nach draußen. Um sich in der Arena zurechtzufinden, bedarf es eines besonderen Vermögens der Seele, das Aristoteles mit Phronesis (lrsnhsix = das Denken, der Verstand, die Gesinnung) Bezeichnet hat. Der Altmeister der Philosopie (=Liebe zur Weisheit) unterschied zehn Seinssinne und drei Vernunftsarten Lehrsatz 1: Das Sein der Welt (die Arena) ist vielfältig; nach einem Einheitsprinzip zu suchen ist fruchtlos. Lehrsatz 2: Der Vielfalt der Seinstypen kann nur mit vielfältigen Seinssinnen und Vernunftarten begegnet werden; wer mit einem falsch gewählten Seinssinn einem bestimmten Seinstyp gegenübertritt, scheitert. Lehrsatz 3: Jeder Seinssinn und jede Vernunftart hat ihre je spezifisch Logik (im Gebrauch und im Ergebnis); die Methodik und der Erkenntniswert z.B. der theoretischen Vernunft sind von anderer »Rationalität« als diejenigen der praktischen Vernunft.
Thales von Milet (um 624 bis 546 v. Chr.) war ein Meister der theoretischen Vernunft, der Wissenschaft (episteme); die Mathematik und Astronomie beherrschte er so genial, daß er zu den Sieben Weisen gerechnet wurde – und doch fiel er in einen Brunnen: es ging ihm der Seinssinn der Phronesis ab. Platon berichtet diesen Vorfall in seinem Dialog »Theaitetos«, um die (häufig lebensschwerfälligen) Philosophen zu verteidigen. Denn Thales soll, »als er, um die Sterne zu beschauen, den Blick nach oben gerichtet, in den Brunnen fiel«, eine »artige und witzige thraktische Magd … verspottet haben, daß er, was im Himmel wäre, wohl strebte zu erfahren, was aber vor ihm läge und zu seinen Füßen, ihm unbekannt bleibe.« Nach Platon hat ein Philosoph den Spott gelassen zu ertragen: »so erregt er Gelächter, nicht nur den Thrakierinnen, sondern auch dem übrigen Volk, indem er aus Unerfahrenheit in Gruben und in allerlei Verlegenheit hineinfällt, und seine gewaltige Ungeschicktheit erregt die Meinung, seine Einfalt sei unverbesserlich.« War Aristoteles weiser als sein Lehrer, der die Vielfalt der Welt stets auf Einheitsnenner (Was ist Tapferkeit an sich? Was ist das Gute an sich? läßt er Sokrates fragen) zu bringen versuchte? Das kurze vierte Kapitel im ersten Buch der »Nikomachischen Ethik« gehört zu den großen Texten der Weisheitsliteratur, weil es die Philosophen aus dem Brunnen und die Einheitsideologen vom Utopiehimmel holt. Das praktisch Nahe zählt mehr als das utopisch Ferne, das Vielfältige mehr als Monistische, und der Lebenssinn für den »rechten Moment« ist für das Zurechtkommen in der Arena wichtiger als das Einheits-An-sich. »So ist die Wissenschaft des rechten Moments im Kriege die Feldherrnkunst, in der Krankheit die Heilkunst, und die Wissenschaft des rechten Maßes bei der Nahrung die Heilkunst, bei den leiblichen Anstrengungen die Gymnastik«. Und die Schlußsätze des 4. Kapitels beschreiben die einfache Sittlichkeit im Alltag (der Arena) nüchtern-genau: »Auch wäre es sonderbar, was es einem Weber oder Zimmermann für sein Gewerbe nützen sollte, das Gute an sich zu kennen, oder wie einer ein besserer Arzt oder Stratege werden sollte, wenn er die Idee des Guten geschaut hat. Auch der Arzt faßt offenbar nicht die Gesundheit an sich in´s Auge, sondern die des Menschen, oder vielmehr die des Menschen in concreto. Denn er heilt immer nur den und den.«
Aus: Walthari, Zeitschrift für Literatur, Heft 19/1993 mit dem Schwerpunktthema Weisheitsliteratur, S. 14 ff.
Bürgergesinnung für eine künftige Zivilgesellschaft
16. Juni 2015
Epochale Versäumnisse im parteienstaatlichen Machtgebrauch
Höchste Zeit für mehr direktdemokratische Korrekturen
Von Univ.-Prof. Dr. E. Dauenhauer
1
Der parteienstaatliche Machtgebrauch löst immer weniger Probleme. Er hat sich damit so sehr vom Verfassungssouverän, den Bürgern, entfernt, daß diese vermehrt in den politischen Streik (Wahlenthaltung) treten. Die Entwicklung hat bei jüngsten Wahlen die rote Linie überschritten: Mehr als fünfzig Prozent verzichteten auf ihr Stimmrecht und haben damit parteienstaatlichen Machthaber die Legitimation entzogen. Denn in Demokratien gilt das Mehrheitsprinzip, oder der Parteienstaat wird zum Phantom. Verzweifelt versucht der Machtapparat davon abzulenken, daß sein Fundament weggebrochen ist. So soll die Wahlpflicht eingeführt und die Wahlperioden noch weiter verlängert werden – untrügliche Zeichen dafür, wie weit sich die Machthaber von der Mehrheit der Bürger entfernt haben. Ohne den Begleit-Tamtam der parteiennahen Medien wäre die Wahlbeteiligung noch geringer. Man treibt den wahlmüden Bürger mit Drohungen und Versprechungen vor sich her, als handle es sich…
2
Vor bald zwanzig Jahren wurden in diesem Walthari-Portal ›40 Hauptsünden des Parteienkartells‹ vorgestellt. Das Sündenregister hat sich mittlerweile beträchtlich erweitert. Wie wenig vorausschauend man agiert, ist aktuell an der Ohnmacht gegenüber dem anwachsenden Flüchtlingsdruck abzulesen. Oder an dem grotesken Schauspiel um die ›Rettung‹ Griechenlands in der Eurozone. Unter direktdemokratischen Verhältnissen wie in der Schweiz wären solche Zuspitzungen unmöglich.
3
Parteienintern und auch in den meisten Medien bricht Panik aus, wenn sich der weitgehend entmündigte Verfassungssouverän, das Volk, in Protestbewegungen Luft macht. Eilfertig wird er verunglimpft und der Teufel an die Wand gemalt. Die links-grüne Diskurshoheit und die Wächter auf den Beobachtungstürmen der Political Correctness werfen sofort die ideologisch gut geölte Empörungsmaschine an und beschallen so heftig den öffentlichen Raum, daß der Verfassungssouverän… So wird gegen die eingeschüchterte Bürgermehrheit die Homo-Ehe, das multikulturelle ›bunte Deutschland‹ mit seinen explosiven Parallelgesellschaften, die feministische Genderei an Hochschulen, die islamische Rechtsunterwanderung, der Asylmißbrauch u.v.a. durchgepeitscht.
4
In realitätsfernen Analysen wird das unstabile Modell der heterogenen Demokratie angepriesen. Dazu gehört, daß die Anpreiser selber in migrantenfreien Stadtvierteln wohnen und ihre Kinder…
Baltimore und Marseille als Vorläufer für Berlin, Frankfurt/Main u.a. Warnung:
»… durch Zuwanderung ist in Deutschland ein neues Subproletariat, das, assimilations- und bildungsfern, in seinen ghettoähnlichen Wohnquartieren…« So schon vor Jahren H.-U. Wehler in Bd. 5 seiner ›Gesellschaftsgeschichte‹, S. 438.
5
Allerfeinst juristische Legitimationen der gegenwärtigen Zustände, begleitet vom Vorwurf des Populismus. Will sagen: das Volk sei politisch unreif. Was schon daran zu erkennen sei, daß fast die Hälfte der Deutschen das Gewaltmonopol des Staates ablehne. Wiederum verschweigen die Legitimierer die Alltagserfahrung, wie sie in der Kriminalitätsstatistik wenigstens halbwegs zum Ausdruck kommt. Auch hier kennen die feinen Herrschaften die Realität nur vom Hörensagen.
6
»Die Idee der Freiheit verlangt, daß so wenig wie möglich geherrscht und regiert werden soll.« Kein Satz aus einem Satireprogramm – Karl Popper. Wer erklärt haben möchte, was Volksvertrauen bei direkter Demokratie bewirkt, lese die ganzseitigen Darlegungen in der NZZ Nr. 66 und 277/2014, S. 12 und 30. Den Text mögen sich die Dauerrepräsentanten der repräsentativen Demokratie als Lehrstücke hinter den Spiegel stecken, ebenso den fundamentalen Beitrag im ›Scheideweg‹ 43/2013/14, S. 188 ff.
7
Glaubt man dem intellektuellen Vorlauf der unbestechlichen Wenigen, sind wir auf dem Weg zur evolutionären Demokratie. Danach nehmen aus mehreren Gründen Volksinitiativen (Anträge an das Parlament), Volksbegehren und Volksentscheide unaufhaltsam solange zu, bis in fundamentalen Fragen nicht mehr gegen den Willen des Verfassungssouveräns regiert werden kann. Ein Parteiengeschacher würde danach gnadenlos abgestraft und abgehobene Politiker ausgeklinkt. Die Mär von sog. instabilen Verhältnissen und der Volksunreife liegen auf der Linie der Verteidigung von … Wo zu viel Geld, keimt Bestechlichkeit; wo zu viel Macht, leiden die Beherrschten. Ein ehernes Gesetz aus langer historischer Erfahrung.
8
Wie den Prozeß der evolutionären Demokratie beschleunigen? Am leichtesten wäre die Vorschrift gesetzlich zu installieren, daß schon die Vorauswahl von Wahlkandidaten nicht mehr den Parteien überlassen wird. Jeder Bürger könnte seine Einmalstimme bei freien Wahlvereinen oder einer Partei ausüben. Bei Quorumspflicht würde sich die politische Kultur schlagartig von Grund auf ändern: Jeder Bürger hätte ein Mitsprachrecht schon auf Kandidatenebene, was die Eignungdebatte befeuern würde. Das Parteienoligopol oder -polypol wäre gebrochen. Jedermann hätte zum ersten Mal Zugang zum Vorhof der politischen Macht und könnte erstmals im offenen Wettbewerb daran mitreden, wen er favorisieren oder verhindern (!) will. Der Anreiz, bereits zur Vorwahl zu gehen, wäre extrem hoch, erst recht bei der Hauptwahl. Wie gesagt: Es darf auch mit Nein gestimmt werden, wenigstens auf Kandidatenebene. Was gerade eine negative Stimmenmacht bewirken kann, belegt die friedliche Revolution in der ehemaligen DDR. Sie kann Diktaturen stürzen. Im rechtsstaatlichen Rahmen wären die Rückstoßeffekte vor der Kandidatenaufstellung der erste evolutionäre Prozeß. Puristische Neinstimmer würden bald ebenso ihren Spaß verlieren wie parteiorthodoxe Kartellisten. Die Wahlen auf zwei Ebenen wären offen und tief bürgerverwurzelt.
9
»Mündige Bürger sind Europa suspekt«, titelte die NZZ Nr. 258/2011, S. 15. Angesichts der Unterstellung, parteienbestimmte Parlamentarier seien grundsätzlich entscheidungskompetenter als das Wahlvolk, ist das mehr als nur eine Ohrfeige. Kenner des Fraktionsbetriebs in den Parlamenten wissen: Der Volksvertreter erhält seine Order von der Fraktionsspitze, diese ihre Order von der Parteizentrale. Eigener Sachverstand oder das Gewissen werden nur in den seltenen Entscheidungsfällen ohne Fraktionszwang verlangt. Beim Bürger hingegen bestehen keine Vorgaben, denen er bei Strafe des Ausscheidens aus dem politischen Betrieb gehorchen müßte. Nur der Bürger ist wahrhaft entscheidungsfrei. In seiner Masse ist er zudem nicht bestechlich wie einzelne Abgeordnete. Und er ließe sich auch nicht zum bloßen Stimmvieh degradieren wie Parlamentarier bei der Einführung und den vielen Euro-Rettungspaketen. Direktdemokratische Korrekturmechanismen hätten nicht nur in diesem Falle abermilliarden Steuergelder erspart und Europa stabiler gehalten.
10
Abwehrtricks können den Weg der evolutionären Demokratie mit mehr Bürgerbeteiligung nicht mehr aufhalten. In Zeiten der digitalen Rundumaufklärung steigt der Druck aus politischer Ohnmachtserfahrung an der Basis. Fundamentale Entscheidung der Parlamente und der Justiz gegen die Mehrheit verstärken den Druck. Ja, auch die Justiz hat sich in wichtigen Lebensentscheidungen im Netzwerk aus Zeitmoden und parteienstaatlichen Gesetzen verfangen, so vor allem im Sozialrecht. Das Zeitalter des »repräsentativen Absolutismus« (Wolf-Dieter Narr) neigt sich seinem Ende zu wie einst die Fürstenherrschaft von Gottes Gnaden.
15. März 2012
Gerechtigkeit als Tugend und Ordnungsprinzip
Von Univ.-Prof. Dr. E. Dauenhauer
Bisher erschienene Artikel
(W = WALTHARI-Heft-Nr.)
1. Was wir ahnen
publ. im W29/1998
2. Tapferkeit
publ. im W32/1999
3. Besonnenheit
publ. im W37/2000
4. Aura – Sehnsucht, Stilisierung, Schicksal
publ. im W36/2001
5. Redlichkeit
publ. am 21. Febr. 2001+04. Nov. 2002
6. Gelassenheit
publ. am 17. März. 2002
7. Bescheidenheit
publ. am 20. Juli 2002+31. Dez. 2007
8. Standhaftigkeit
publ. am 08. Okt. 2002
9. Dankbarkeit
publ. am 11. Nov. 2002
10. Tiefer Richtungssinn, Ma’at
publ. am 07. Dez. 2002
11. Privatheit und Askese
publ. am 19. Juni 2003
12. Hochherzigkeit
publ. am 09. Juni 2004
13. Das verachtete Tugendquartett: Bescheidenheit, Dezenz, Bedürfnisbeschränkung, Askese
publ. am 24. Okt. 2005
14. Klugheit
publ. am 29. Januar 2007
15. Hexis / Habitus
publ. am 30. Juni 2007
16. Torheit als Tugend
publ. am 26. August 2007
17. Das Geziemende, Angemessene
publ. am 15. Sept. 2007
18. Prohairesis – eine vernachlässigte Tugend)
publ. am 24.Okt. 2007
19. Scham zwischen Verachtung und Mißbrauch
publ. am 02. Feb. 2008
20. Dezenz
publ. am 13. Juli 2008
21. Großmut, Hochherzigkeit, Freigebigkeit
publ. am 29. Nov. 2008
22. Weisheitliche Signatur: Heiterkeit (teilw.)
publ. am 24. Juli 2009
23. Demut – eine verlachte Tugend
publ. am 22. Nov. 2009
24. Beharrlichkeit – eine hinderliche Tugend?
publ. am 17. Aug. 2010
25. Gerechtigkeit als Tugend und Ordnungsprinzip
publ. am 12. März 2012
1
Zwischen den zahlreichen Lehren der Gerechtigkeit und dem derzeitigen gesellschaftlichen, politischen und privaten Gerechtigkeitsverständnis existiert ein Bruch. War noch für Platon und Aristoteles die Gerechtigkeit die Klammertugend des ethischen Verhaltens und für Cicero der »höchste Glanz« (splendor maximus), so ist sie seit dem 19. Jahrhundert real und diskursiv zur bloßen Verteilungsgerechtigkeit (soziale Gerechtigkeit) und zum politischen Beißbalg der sog. Gerechtigkeitslücke geworden. Alle Unterscheidungen, die von den Vorsokratikern bis zu den Rechtsphilosophen unserer Tage getroffen wurden und werden, scheinen vergessen oder mißachtet. Gerechtigkeit ist zum Kampfbegriff geworden. Mit ihr wird sogar legislativ und judikativ Schindluder getrieben, so sehr, daß die Meinung wächst, man solle auf sie verzichten, denn offensichtlich gebe es sie gar nicht.
2
In der Philosophie und in den Geistes- und Sozialwissenschaften wird Gerechtigkeit seit je verschieden definiert. Man ist sich aber in folgenden Punkten einig:
- Gerechtigkeit orientiert sich an sozialen, aber auch an innerpersönlichen Referenzwerten. Sie zeigt sich zwar besonders mit Bezug auf Menschen in der Treue und der Dankbarkeit, wurzelt aber letztlich in einer ich-haften geistigen Mesoteshaltung (vgl. unten). Robinson auf seiner einsamen Insel, schreibt O.Fr. Bollnow, muß sich über Gerechtigkeit keine Gedanken machen (in: Die Ehrfurcht. Wesen und Wandel der Tugend, Kapitel XIII: Die Gerechtigkeit, Würzburg 2009, S. 209).
- Der allgemeine Gerechtigkeitsbegriff kann in Unterformen aufgegliedert werden. Es gibt danach eine ökonomische, gesetzlich, ethische usw. Gerechtigkeit.
- Von Gerechtigkeit geht eine moralische, gesellschaftliche, politische und gesetzliche Ordnungs- und Friedensfunktion aus. Ungerechte Gesetze und Wirtschaftsordnungen sind auch moralisch zu verwerfen. Sie gefährden das friedliche gesellschaftliche Zusammenleben und beschädigen die politische Legitimation.
- Es gibt zwei verschiedene Manifestationen (nicht Maße), an denen sich Gerechtigkeit erweist: an Haltung und Handlung. Was S. Pufendorf zuerst unterschieden, ist seit I. Kant vorherrschende Tendenz: die handlungsorientierte Gerechtigkeitsbetrachtung hat die haltungs- oder tugend-orientierte stark zurückgedrängt. Für Kant war Gerechtigkeit primär keine Tugend, sondern eine »Eigenschaft der Gesellschaft im bürgerlichen Zustand (›status civilis‹)« (F. Loos u.a.: Gerechtigkeit, in: HWPh, Bd. 3, Sp. 330 ff.).
3
Uneins ist man in den Lehren der Gerechtigkeit über folgende Punkte:
4
Entwickelte Gerechtigkeitslehren haben vorgelegt:
- Platon: …
- Aristoteles: …
- Augustinus: …
- Anselm von Canterbury: …
- Luther: …
- Bacon: «Man schuldet es der Gerechtigkeit, daß der Mensch dem Menschen ein Gott ist, kein Wolf.«
- Leibniz: …
- Hobbes: …
- Locke: …
- Hume: Für ihn erweist sich Gerechtigkeit ausschließlich am öffentlichen Nutzen, d. h. am Glück aller und am Frieden.
- Hegel: …
- Kelsen: »Absolute Gerechtigkeit ist ein irrationales Ideal.« Rationale Definitionen (wie bei Kant) verwirft er als »völlig leere Formeln«.
- Bollnow: Er sucht den zurückgedrängten Haltungs-(Tugend-)teil der Gerechtigkeit, wie er in der Antike und im Mittelalter vorherrschte, wieder zu reaktivieren und erinnert an Platons Königstugend: »Der einzelne Mensch ist bei ihm gerecht nicht in der Beziehung zum Staat und zum andern Menschen, sondern rein in sich selber, und er erfaßt sich in seinem Wesen nur im Spiegel des Staats. Grundsätzlich hat also der Mensch die Gerechtigkeit nicht anders, als er die Besonnenheit oder die Tapferkeit oder die Weisheit hat. In sich selber ist er gerecht. Und wenn man fragt, was hier die Gerechtigkeit heißt, so gibt Platon eine Antwort, die dem, der von der heute üblichen Auffassung ausgeht, völlig unerwartet kommen muß. Er sagt nämlich, der Mensch sei gerecht, wenn er in sich selbst das rechte Gleichgewicht zwischen den drei von Platon unterschiedenen Seelenteilen herstellt, wenn er der Sinnlichkeit, der von Platon mit dem schwer übersetzbaren Wort thymos bezeichneten vitalen Aktivität und der Vernunft jeweils ihren gerechten Anteil am eignen Wesen zuerkennt. … Es handelt sich um das harmonische Gleichgewicht zwischen den Kräften im Menschen. …Es ist diejenige Tugend, die aller einseitigen Zuspitzung einzelner Tugenden entgegenwirkt und in einem größeren Ganzen jeder einzelnen Tugend ihren ›gerechten‹ Platz zuweist.« Sie »ist nicht wie jene andern Tugenden Kraft zu etwas, sondern steht in sich ruhend schlechthin da. So steht die Gerechtigkeit bei Platon im engsten Zusammenhang mit einem Geist, der bei Aristoteles dann den mesotes-Charakter jeder einzelnen Tugend bedingt. Es ist die Übertragung des griechischen Maßbegriffs auf den Kosmos der Tugenden. In diesem Sinn ist es klar, warum diese besondere Tugend des Menschen bei Platon die herrschende Tugend ist« (a.a.O., S. 274 f.).
5
Aus der Perspektive dieses tiefen Gerechtigkeitsbegriffs muten ›moderne‹ Auffassungen als primitive Formen an. Im politischen und gesellschaftlichen Diskurs wird Gerechtigkeit schlechterdings mit sozialer Gerechtigkeit gleichgesetzt. Damit wird nicht nur die Mesoteswirkung gekappt, auch der Referenzarm der Gerechtigkeit verarmt als bloße Verteilungsgerechtigkeit und entwertet komplementäre Werte wie Freiheit und Solidarität. Man lese dazu Parteiprogramme und höre sich die täglichen Forderungen nach sozialer Gerechtigkeit an. Die Schwerthiebe unter dem Motto der sozialen Gerechtigkeit werden von der Vorstellung sozialer Gleichheit angetrieben, die einen demontierenden Umverteilungsmechanismus in Gang setzt – auf Kosten der Freiheit und Solidarität. Den Schlachtrufen ›Gerechtigkeit für alle!‹ und ›Weg mit der Gerechtigkeitslücke!‹ liegt eine Gleichheitsideologie zugrunde, die zweierlei leugnet: daß soziale Ungleichheit nicht zu beseitigen ist und daß eine gemäßigte soziale Ungleichheit, also eine milde Form von sozialer Ungerechtigkeit, sogar erwünscht ist, um dynamische gesellschaftliche und individuelle Prozesse am Laufen zu halten. Die gängige Gerechtigkeitsrhetorik beutet Sozialängste aus und verspricht eine unrealistische Sicherheitssehnsucht – der Nährboden für Freiheitsverluste. Autoritär verordnete Gleichheit läuft zwangsläufig auf Wohlfahrts- und Freiheitsverlust hinaus, weil sie Synergien und Selbstverantwortung kleinhält. Daneben beschränkt sie sich auf materielle Verteilung und hat somit keinen Blick für den großen geistigen Ausgriff der Gerechtigkeit (vgl. oben). Dieser weite Begriff kämpft nicht mit der Freiheit um den Vorrang, sondern ›weiß‹ um das gegenseitige Bedingungsverhältnis. Es ist auf den immens aufgeblähten sozialpolitischen Propaganda-Apparat zurückzuführen, wenn in Deutschland der Wert der Freiheit weit hinter der Sicherheit rangiert und die Solidarität in einer staatlich-anonymen Sozialindustrie verkommt. Der Sozialstaat hat sich zum Leviathan aufgebläht, unter dessen Fürsorgedach die Klagen über Ungerechtigkeit zum Cantus firmus geworden sind.
6
Der Frage ›Was ist gerecht?‹ haben seit Platon die Fragen vorauszugehen: ›Wie werde ich gerecht?‹ und ›Welche Ordnung schafft ein rechtschaffendes Zueinander?‹ Der zweiten Frage gebührt der Vorrang vor der ersten und dritten…
7
In den letzten Jahrzehnten kam es, in Auseinandersetzung mit dem Fairnessansatz von Rawls, zu erstaunlichen Rückbesinnungen, genauer gesagt zur Besinnung auf längst gesicherte Positionen. Antreiber dafür war insbesondere der Kommunitarismus, der darauf beharrt, daß Gerechtigkeit weniger an der abstrakten Menschheit als an konkreten Individuen zu messen sei. Einer der geistigen Väter, Michael Walzer, erinnerte 1983 daran, daß es die universale Gerechtigkeitsidee gar nicht geben könne; was gerecht sei, ergebe sich in überschaubaren gesellschaftlichen Verbänden, die sich durch enge Kooperation und damit durch eine starke Mentalitätskohärenz auszeichneten. Es gibt nach diesem Ansatz viele Gerechtigkeitsideen, die jeweils folgende Leitpostulate in ein Verhältnis setzen, damit erkennbar wird, was als gerecht empfunden werden kann: Freiheit, Gleichheit (vor dem Gesetz), Menschenwürde, Solidarität und Autonomie (des Individuums). In islamischen Kulturkreisen herrschen andere Gerechtigkeitsvorstellungen als in christlichen. Doch bei aller Verschiedenheit darf auf das universalistische Grundmuster, das sich in der Jahrhunderten der Aufklärung herausgeschält hat, nicht verzichtet werden. Die Unterschiede rechtfertigen z.B. nicht, daß man gegenüber Notleidenden nicht solidarisch handeln muß. Das wäre kulturübergreifend so ungerecht (ein Verstoß gegen die Solidarität) wie geschlechtsspezifische Rechtseinschränkungen (Verstoß gegen die Gleichheit vor dem Gesetz). Aus der bloßen Rahmenfunktion der fünf Leitkategorien (vgl. oben) ergibt sich noch keine Gerechtigkeit. Diese entsteht vielmehr…
8
Mit den vorstehenden Überlegungen lassen sich Antworten finden auf die Ausgestaltung der drei Gerechtigkeitssparten, die Aristoteles im Buch 5 seiner Nikomachischen Ethik vorgeschlagen hat.
- Justitia legalis: Die Gesetzesgerechtigkeit ist umso gefährdeter, je universalistischer ihr Anspruch ist. Der lex universalis haben leges speciales an die Seite zu treten, da Generalklauseln nicht alle Fälle gerecht regeln können. Die Entscheidung darüber wird umso gerechter empfunden, je kommunitaristischer sie getroffen wird. Die Orestie liefert dafür einen Musterfall seit zweieinhalbtausend Jahren.
- Justitia distributiva: Die so häufig ins Verschwenderische ausufernde Verteilungsgerechtigkeit kann ebenfalls kommunitaristisch auf berechtigte und damit gerechte Maße beschränkt werden. Im anonymen Mechanismus der Sozialindustrie läuft sie entlang formalen Anspruchsdenkens aus dem Ruder.
- Justitia communicativa: Für die Tauschgerechtigkeit hat bereits Herodot das klassische Lösungsmuster mit seinem Afrikahandel geliefert (vgl. Wirtschaftskategorien, 2011, S. 45 f.). Treten unter den bekannten Fairneßbedingungen des Marktes (offen, frei, rechtsförmig und sanktionsbewehrt) Tauschpartner einander gegenüber, erzwingt die Lage einen gerechten Ausgleich. Kein Partner wird tauschen, wenn er keinen Vorteil erzielen kann – ein zweiseitiges Geschäft also, das erst abgeschlossen wird, wenn es beide Partner als gerecht ansehen. Märkte sind daher die Urform der Demokratie, lange bevor die politische Theorie sie entdeckt hat. Hier hat der Spruch ›Jedem das seine‹ die volle Be-Rechtigung. Im Tausch entsteht Gerechtigkeit über das Ökonomische hinaus. Denn…
9
Die ›naturwüchsige‹ Herleitung der Gerechtigkeit aus dem Tausch – er ist als anthropologische Konstante ein Teil der Natur des Menschen und zivilisatorisch eine rechtskonstituierende Alternative zur Gewalt – wirft die Frage nach dem Verhältnis von Gerechtigkeit und Recht auf. Wie dargelegt, kann Gerechtigkeit nicht nachhaltig verordnet werden, sie ist auf Akzeptanz angewiesen und setzt ein subjektives Gerechtwerden voraus (›Wie werde ich gerecht?‹ geht der Frage ›Was ist gerecht?‹ voraus). Um aber dauerhaft wirksam zu bleiben, muß eine Antwort auf die dritte Frage gefunden werden: Welche Ordnung schafft ein rechtsstiftendes Zueinander? Hier geht es um den Übergang von Gerechtigkeit in Recht oder um die Fragen, wieviel Gerechtigkeit im Recht stecken muß und wohin ein Recht ohne Gerechtigkeit führt. Dazu muß man drei wichtige Unterschiede festhalten:
In modernen Rechtssaaten arbeitet hingegen die Gesetzesmaschine (diese Metapher besteht zurecht) systemformal und damit fernab von Rückbindungen an Gerechtigkeitsüberzeugungen. Dabei gilt: Je größer das staatliche Gebilde, umso größer die Kluft. In der kantonal verfaßten Schweiz ist die Verbindung von Recht und Gerechtigkeit direktdemokratisch verankert. Sollte es zu einem europäischen Bundesstaat kommen, wäre ein urdemokratisches Anliegen, nämlich Gesetze auch mit Gerechtigkeitsüberzeugungen zu legitimieren, aufgegeben. Das ist in der Europäischen Union vielfach heute schon nicht der Fall.
Die Volltextversionen aller Tugendbetrachtungen sind als Buchveröffentlichung erschienen:
Aktive Bürgergesellschaft in einem gebändigten Staat
Aus dem Inhalt
Der Bürger: Mal in guter, mal in schlechter Gesellschaft, immer aber in parteienstaatlichen Händen?
Sieben Weisen: Welches ist der beste Staat?
I. Vor-Orientierungen
Was versteht man unter einer Bürgergesellschaft?
Aktive Bürgergesellschaft – eine Utopie in Zeiten des Individualismus und der globalisierenden Spätmoderne?
Lassen sich nationale und supranationale Staatsgebilde bürgergesellschaftlich bändigen?
Was bedeutet aktives Da-Sein in einer Bürgergesellschaft?
II. Grundlagen
Repräsentanz und direkte Demokratie
Unabhängige Eliten: die dritte Säule einer bürgergesellschaftlichen Demokratie
Die Rolle von Schulen, Medien, Verbände und Nichtregierungsorganisationen in einer aktiven Bürgergesellschaft
Strukturen, Auswüchse und Begrenzung der Parteiendemokratie
Vom Grundgesetz zu einer bürgergesellschaftlichen Verfassung
III. Einige ideengeschichtliche Herleitungen
IV. Grundweisende Bürgerlichkeitskonzepte
V. Bürgerliches und staatliches Mißlingen
Warum Gesellschaften und Staaten untergehen
Konkrete Gefährdungen der Bürgerlichkeit
Parteienstaatliches Mißlingen
VI. Bürgerliches und staatliches Gelingen
Ideengeschichtliche Erkenntniserträge
Systemelemente einer gelingenden Bürgerlichkeit in einem gebändigten Staat
V. Anhang
Direktpreis: EURO 23,- zzgl. Versandkosten / Buchhandelspreis: EURO 33,-
233 Seiten, Hotmeldbindung, flexibler Einband
Literaturbesprechungen
28. September 2018
Brüschweiler, A.: Die religionsgeschichtlichen Grundlagen des Dialoges Timaios,
Verlag Königshausen & Neumann, Würzburg 2018, 114 Seiten, 28,- Euro ISBN 978-3-8260-6388-6
Wenn dieser Verlag einen Titel aus seinem antik-kulturellen Programm anzeigt, kann man sicher sein, daß solide Arbeit geleistet wurde. Ich bin als Rezensent nicht erst 2002 auf den Königshausen & Neumann-Geschmack gekommen, als ich P. Gardeyas ›Platons Teaitetos‹ in diesem Walthari-Portal besprochen habe. Dort geht es um Erkenntnistheorie, die ich in meinen Vorlesungen einflechten konnte. Der vorliegende schmale Band von Brüschweiler ist weniger philosophisch als religionsgeschichtlich von höchstem Interesse. Der Autor vergleicht zitatenreich die Schöpfungsgeschichte der Bibel und die heilsgeschichtlichen Verheißungen des Alten Testaments mit »den Erkenntnissen (!) der ionischen Philosophie über die jenseitige und materielle Schöpfung (soweit diese Erkenntnisse überhaupt mittels Quellen überliefert wurden)«. Gerade Platon bleibt vieles als Geheimlehre verborgen und nur indirekt erschließbar (vgl. dazu: Schefer, Chr.: ›Platons unsagbare Erfahrung‹, Basel 2001, besprochen am 24. Januar 2004 in diesem Walthari-Portal). Brüschweiler legt nun zwei Textspuren nebeneinander, die ionische und die biblisch-alttestamentarische, und entdeckt dabei erstaunliche Parallelen und sogar Deckungsgleichheiten: Stammväter hier wie dort, ebenso Abfallnarrative, »Engelsstürze«, Hölle-Hades-Parallele, Retterfiguren, Aufstieg zur höheren Ordnung usw. Im ionischen Weltbild bleibt vieles verschlüsselt, während die Bibel deutliche Worte findet. Beide Schöpfungslehren kennen einen Erstgeborenen und große Prüfungen, die bei Nichtbestehen, die Erschaffung von »verschiedenen materiellen Lebensformen auf der Erde« zur Folge hat. Wer einmal in den Textvergleich eingestiegen ist, liest gebannt weiter, denn die Folgen der vergleichenden Herausarbeitung sind gravierend etwa für das jüdische singuläre Erwählungsnarrativ. Erhellend auch der Befund Brüchweilers, daß die rasche Ausbreitung des Christentums in der Spätantike durch die Strukturverwandtschaft mit dem ionischen Weltbild in neuem Licht erscheint (112). Die Vergleichsanalyse ebnet freilich die erheblichen spirituellen Unterschiede beider Schöpfungs- und Weltbilder nicht auf.
12. Mai 2018
Littlehales, Nick: Sleep. Schlafen wie die Profis
Albert Knaus Verlag, München 2018, 236 Seiten, 16,- Euro, ISBN 978-3-8135-0787-4
Der aufgeklärte Leser muß drei Zumutungen überwinden, ehe er in die informativen zehn Kapitel einsteigt: Warum ein englischer Haupttitel, wo doch werbeträchtige deutsche Wörter zur Verfügung stehen? Wozu die vielen englischen Quellenangaben (mit leichten deutschen Einsprengseln), die kaum einem deutschen Leser nützen? Warum werden Quellen der deutschen Schlafforschung ausgespart? Es scheint unter Verlagen hierzulande immer mehr Mode zu werden, Lizenzausgaben mit nur kosmetischen Hinzufügungen dem Publikum zu servieren und der Anglifizierungsneigung (»performen« usw.) der Übersetzer keinen Einhalt zu gebieten. Wer diese nicht geringen Zumutungen wegzustecken bereit ist (wozu kein angelsächsischer Leser im Umkehrfalle bereit wäre), stößt (als fachlich orientierter Leser) weitgehend auf Bekanntes, doch die narrative Authenzität des Autors lohnt den Einstieg in den Text. Der Autor ist weder Arzt noch Wissenschaftler, dafür um so mehr ein erfahrener Praktiker, der sich als »Schlaf-Couch internationaler Sportler« gut verkauft. Er verspricht einerseits keine Schlafdiät (17), in sein »R90 Sleep Recovery Programm« geht dennoch eine »Paleo-Schlaf-Diät« (19) ein. Er verspricht, den Schlaf seiner Leser innerhalb von »gerade mal sieben Wochen zu revolutionieren« (18). Dazu stellt er in Teil 1 ›Schlüsselindikatoren für erholsamen Schlaf‹ vor, das sind bekannte Erkenntnisse über Rhythmen, Zyklen, Schlafausstattung, Schlafumgebung usw. Teil 2 lautet ›R90 in der Praxis‹, der Autor präsentiert sein spezielles Schlafprogramm, geht auf Schlafprobleme ein und wird in Kapitel 10 intim. Was kann der Leser lernen? (1) Daß Schlaf ein kompliziertes und geheimnisvolles Evolutionsgeschenk ist, das zu mißachten eine Lebensdummheit mit schweren Folgen ist. (2) Man sollte mehr auf zirkadiane Schlafrhythmen als auf die Schlafdauer achten. (3) Daraus ergeben sich individuelle Schlafmuster, die man pflegen soll. (4) Förderlich sind zahlreiche Requisiten (Schlafumgebung usw.). (5) Der Schlaftypus kann bis zur individuellen Liegeposition durchschlagen. Nicht jedem Leser wird die geschilderte Schlafverplanung gefallen, da sie ein diszipliniertes Zeitbewußtsein verlang, doch die Natur spricht dafür.
11. Mai 2018
Brissa, Enrico: Auf dem Parkett
Kleines Handbuch des weltläufigen Benehmens
Mit Illustrationen von Birgit Schössow, Siedler Verlag, München 2018, 272 Seiten, 18,- Euro, ISBN 978-3-8275-0112-7
Schon im formalen Aufbau ein sehr nutzerfreundliches Buch: gleich zu Anfang ein Verzeichnis der Begriffe und am Ende ein umfangreiches Register (16 Seiten). Da findet sich der Leser problemlos zurecht und kann, wenn nicht schon fündig bei den Begriffen, im Register die gewünschten Textstellen ausfindig machen. Am weltläufigen Benehmen fehlt es heutzutage mehr als in der Vor-68er-Zeit, als die Regeln des Anstandes noch nicht unter der Walze der Tabubrecher zermalmt worden waren. Der zivilisatorische Flurschaden ist allerorten, besonders in den Schulen und im Netzbetrieb, zu besichtigen. Brissa schreibt gegen die Höflichkeitsverwahrlosung von der hohen Warte eines Protokollchefs (zuerst im Bundespräsidialamt, danach im Bundestag) an. Beschrieben werden rund 140 Leitbegriffe, bei deren Lektüre sich abwechselnd Respekt vor dem Mut und Trauer über die Benimmdifferenzen im Alltag, in der Politik usw. einstellt. Gute Manieren sind eben ein knappes Gut, das Brissa mustergültig beschreibt: Es geht nicht nur um formal korrekte Umgangsformen, vielmehr sind Manieren »ein essentieller Teil des Menschseins« (142). In der Tat liegt es an den vielen historischen Brüchen in Deutschland, wenn hierzulande ein unmanierlicher Sonderweg zu beobachten ist, der gegenwärtig durch die massenhafte fremdkulturelle Einwanderung noch verstärkt wird (manche Großstadtviertel sind mittlerweile manierlos).
Ich lese einige Dutzend Einträge und fühle mich dabei wie in einem Reparaturbetrieb einer beschädigten Kultur. Ob Anrede oder Krawatte, E-Mail oder Bezahlen, es wird jeweils nicht nur beschrieben, was sich schickt, sondern auch warum. Die Perspektive schließt die hohe Schule der Diplomatie ein. Schreibt deshalb Brissa von einer zu hohen Warte? Keineswegs. Dazu muß man nur den kurzen Beitrag über Strümpfe lesen. Oder über die Höflichkeit im Straßenverkehr.
12. April 2018
Kast, Bas: Der Ernährungskompass
Das Fazit aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung
C. Bertelsmann Verlag, München 2018, 320 Seiten, Fadenbindung, 20,- Euro, ISBN 978-3-570-10319-7
Der Untertitel (›aller wissenschaftlichen Studien zum Thema Ernährung‹?) macht stutzig, weil Aberhunderte erschienen sind, die ein einzelner Autor allein gar nicht auswerten kann. Doch nimmt man die Übertreibung um so gelassener inkauf, je weiter man liest. Zum formalen Aufbau des Buches: wölf Kapitel mit einer Einführung und einem zusammenfassenden Epilog: ›Meine 12 wichtigsten Ernährungstipps‹. Dazu ein umfangreiches Literaturverzeichnis (neun Seiten), 12 Seiten Anmerkungen und leider ein zu dürftiges Register (fünf Seiten). Bekanntlich rechnet die Ernährungswissenschaft in den Disziplinen mit den geringsten Halbwertzeiten. Es ist daher schwer, zeitüberdauernde ›Universalien‹ auszumachen. Kaffeegetränke werden einmal verteufelt, dann wieder gelobt, ebenso ergeht es dem Brotverzehr und Dutzenden anderen Lebensmitteln. Bezeichnend ist die Spinnennetzgraphik auf Seite 172. Ausgewertet wurden ›alle großen Analysen‹ für die Metaanalyse, die zwar ein uneinheitliches Bild vermittelt, aber doch Tendenzen angibt. Milch z.B. wird zu 60 Prozent als neutral und in 24 Prozent als schützend bewertet. Bei rotem Fleisch lautet das Ergebnis mehrheitlich: schädlich. Bei Fisch hingegen fallen die Bewertungen ohne Tendenz aus: 44 % positiv, 50 % neutral und zwei Prozent schädlich. Bei Obst/Gemüse sind Plus und Neutral praktisch gleichauf, nur zwei Prozent negativ. Was die Datenvorstellung von Kast auszeichnete: Er differenziert sehr stark. Was macht der Autor aus dem Befund über Milch? Er unterscheidet sehr sorgfältig (so zwischen Frauen und Männern) und kommt für sich zu dem Schluß: »Ich war immer ein fleißiger Milchtrinker und bin es jetzt nicht mehr« (189). Im Normalfall (d.h. ohne Rücksicht auf eine gesundheitliche Speziallage) sollte der Milchkonsum nicht zwei Gläser täglich überschreiten. Eine Milchverteufelung ist also fehl am Platze. Über eine Milliarde Chinesen verträgt keine Milch, ohne daß es zu Gesundheitsschäden oder Frühsterblichkeit kommt. Zwei Kapitel über Proteine, je drei Kapitel über Kohlenhydrate und Fette, dazu Kapitel über Diätfasten, Vitaminpillen, Milch, Kaffee, Tee und Alkohol und am Schluß die zwölf ›Gebote‹ einer gesunden Ernährung: ein flott und sehr ausgewogen geschriebener Ratgeber.
4. Februar 2018
Engelberg, Ernst: Bismarck. Sturm über Europa. Biographie
herausgegeben und bearbeitet von Achim, Verlag Pantheon, München 2017, 864 Seiten, 59 s/w Abbildungen, 20,- Euro, ISBN 978-3-570-55289-6
Diese Ausgabe ist fast textidentisch mit der Hardcover-Ausgabe des Siedler-Verlages aus dem Jahr 2014, die in diesem Walthari-Portrait am 5. Dezember 2014 ausführlich besprochen wurde. Eine nochmalige Rezensionsanzeige lohnt sich, weil nun das Buch als ›Taschenbuch‹ zum halben Preis zu haben ist und weil in unseren nationenskeptischen Zeiten diese Biographie an ein unverzichtbares politisches und gesellschaftliches Fundament erinnert. In der nationalistischen Epoche nach 1871 gab es in Deutschland Hunderte Bismarcktürme, darunter auch einen in Landau/Pfalz direkt hinter der Universität, den man nach 1945 herunterkommen ließ, gleichsam als Symbol für den zweiten Bismarcksturz in den Jahren der Umerziehung und der Wendeübungen deutscher Historiker. Noch im Juli 1944 bewunderte Theodor Schieder in Königsberg den Reichskanzler und beeinflußte später seinen einflußreichen Schülerkreis (H.-U. Wehler u.a.). Seine Zunft stellte sich nach 1945 in die angelsächsische Propaganda der Anti-Hunnen-Kampagne. Die DDR sah das anders, der Marxist Ernst Engelberg schrieb wohlwollend über den Reichsgründer. Demgegenüber sah Bundespräsident Gustav Heinemann in einer Rede am 18. Januar 1971 den ›Eisernen Reichskanzler‹ als eine Art Vorbereiter der Nazigreuel. Nur vereinzelt gab es Gegenlicht, so von Alfred Herrhausen kurz vor der Wende 1989. Vier Wochen später fiel er einem Attentat zum Opfer. Von alledem ist in der Engelberg-Darstellung nichts zu lesen, eine Lektüre lohnt sich aber, um die Nachwirren angemessen einzuordnen.
Ausgewählte Beiträge von 2004 bis 2010
Persönlichkeitsmanagement
13. September 2010
Ferdinand Freiligrath
geb. am 17.Juni 1810 in Detmold, gest. am 18. März 1876 in Bad Cannstatt
Sein ehemals großer Ruhm als Dichter und Patriot ist im heutigen kollektiven Gedächtnis der Deutschen auf einen Restposten in Literaturlexika zusammengeschrumpft. Es demaskiert die links-grüne Medienlandschaft, daß sein 200. Geburtstag fast vollständig übergangen wurde. Vielleicht einer unter zehntausend Bürger kennt noch eines seiner Gedichte. Anthologien sparen ihn aus, er paßt nicht mehr in den heimatlos flatternden Zeitgeist. Dabei erwarb sich der Lehrersohn große Verdienste auf dem Weg zur Deutschen Einheit 1871. Als er 1868 aus dem Londoner Exil zurückkehrt, feierten ihn die Zeitgenossen als Patrioten und Sozialrevolutionär. In seinem Gedicht (›Von unten auf‹, 1846) schildert er den preußischen König auf seiner Rheinfahrt und läßt den Schiffsheizer als »Proletarier-Maschinist« das Feuer der Revolution schüren. Es blieb dem Spötter Heinrich Heine vorbehalten, über Freiligrath herzufallen, der in seinen besten Gedichten keineswegs einer Kriegspoesie verfallen war. Eine Sturmtrompete wird zerschossen und ist nur noch als »klanglos Wimmern« zu vernehmen, ein »Schrei voll Schmerz«. Das könnte man auf das kollektive Vergessen übertragen.
21. November 2010
Schopenhauer, A.: Senilia. Gedanken im Alter
herausgegeben von Franz Volpi und Ernst Ziegler
C. H. Beck Verlag, München 2010, 374 Seiten, 29,95 Euro
Dieses Buch gewährt tiefe Einblicke in die verschachtelten Denkkammern eines der einflußreichsten Geister der deutschen Kultur. ›Gedanken im Alter‹ lautet der Untertitel, was erwarten läßt, daß der knorrige Philosoph in seinen letzten Lebensjahren noch knorriger über das Weltgeschehen denkt und urteilt. Und so ist es auch. Franco Volpi bereitet in seiner Einleitung den Leser darauf vor. Die Eintragungen beginnen im Jahre 1852 und enden 1860 mit dem Tode Schopenhauers. Volpi nennt die ›Senilia‹ das »philosophische Testament«, in dem es bunt zugeht: »Zitate, Reflexionen, Erinnerungen, wissenschaftliche Überlegungen, psychologische Beobachtungen, Beschimpfungen und Tiraden gegen seine Gegner, Entwürfe und Pläne, Benimmregeln und Lebensmaximen. Es sind die letzten Tropfen der Weisheit, die das Philosophieren ihm bietet: eine geistige Arznei, die ihm das Alter erträglich und sogar angenehm macht.«
Die Erbärmlichkeit der conditio humana war der Generalbaß aller Schopenhauer-Schriften, aber hier dominiert der Grundton alle Obertöne. Kants Lehre war für ihn »die einzige ernstliche und große Leistung der Philosophie« (S. 90). Spott und Hohn gießt er auf die »Universitäts-Philosophie«, man solle die »Philosophie-Profeßoren« von den Hohen Schulen fernhalten. Die Kirche steht für Schopenhauer der Wahrheit im Wege. Theologen beschimpft er als »Antagonisten der wirklichen Philosophie« (S. 94). »Gelehrsamkeit« stehe im umgekehrten Verhältnis zur »Gottseligkeit«. Er mokiert sich gar über den »Hegelschen Unsinn«. An der »Göthe’schen Farbenlehre« zweifelt er allerdings so wenig wie an seiner eigenen, die heute niemand mehr kennt. Man liest also viel Überhebliches und Üb erholtes, dennoch sind die ›Senilia‹ ein historisches Dokument von großem Gewicht. »Die deutsche Sprache ist der Dummheit in die Hände geliefert« (S. 154). Bekanntlich war Schopenhauer nicht nur ein scharfer Denker, sondern auch ein unerbittlicher Sprachzensor. Davon gibt es in den ›Senilia‹ reichlich Proben (so auf S.212). Das Buch hilft mit einem Personenregister; für die Themenorientierung muß sich der Leser mit einer ›Übersicht der Senilia‹ genügen, was aber ein Sachregister nicht ersetzt. Franco Volpi führt einleitend in das Denken Schopenhauers ein, Ernst Ziegler hat ein zwanzigseitiges editorisches Nachwort verfaßt. Auf acht Seiten werden Manuskriptproben abgebildet, die den Überarbeitungseifer bezeugen. Das »Ding an sich« (Kant) ist für den Philosophen des Pessimismus die blinde, unergründliche Schöpfungskraft, die keinem Zweck dient; jede Ordnung erweist sich als Blendwerk. Vergeblich alle menschlichen Versuche, der irrationalen Kraft seinen Willen aufzuzwingen. Das Leben ist nach Schopenhauer nicht wert, gelebt zu werden, überwiegen doch Elend und Schmerz. »Das Leben ist ein Geschäft, welches die Kosten nicht deckt« (›Die Welt als Wille und Vorstellung‹, Bd. 2). Schien dieses Motto auf ihn selber bis vier Jahrzehnte zuzutreffen, so erfuhr der »Kaspar Hauser« der Philosophie im Alter hohe Anerkennung und damit glückliche Jahre. Dieser Zeit entsprangen die ›Senilia‹, die als ars bene vivendi gelesen werden können. Das steht in Opposition zu seiner verkündeten Weltanschauung. Philosophie, heißt es jetzt, habe dem Leben praktische Orientierung zu geben, um die Sorge um sich selber lebensweisheitlich zu gestalten. Davon legen die ›Senilia‹ Zeugnis ab, die unter dem Motto stehen: Die eigene Existenz als Kunstwerk gestalten. Nietzsche griff diese Formel auf und prägte ein ganzes Zeitalter. Doch Cicero ist stets mitzubedenken: »senectus, quam ut adipiscantur omnes optant, eudem accusant adepti.«
18. Dezember 2009
Direkte Demokratie und Bürgergesellschaft
Dr. E. Dauenhauer
13. Folge
Idee und Praxis direktdemokratischer Bürgerbeteiligung hat unter deutschen Journalisten und Parteipolitikern nur wenige Freunde. Dabei werden Vorurteile, Halbwissen und Ängste bewußt ins Spiel gebracht, um die Alleinherrschaft der repräsentativen Demokratie zu sichern. Diese Herrschaftsform befindet sich gänzlich in den Händen der Parteien, die sich vom Volk (dem Verfassungssouverän) zunehmend abgekoppelt haben, indem sie sich gegenüber dem Volkswillen weitgehend immun eingerichten. Zur Immunisierungsstrategie gehören Zulassungsschranken zum Parteienkartell, das konkurrierende Wahlvereine weitgehend ausschließt. Schon bei der Kandidatenaufstellung im Parteienkartell haben Bürger, die nicht Mitglied einer Partei sind (kaum mehr als ein Prozent aller Bürger gehören einer Partei an), keinerlei Mitbestimmungsrechte.
Die Schwächen dieser Parteienherrschaft, die sich den Staat zur Beute gemacht hat, sind unzählige Male beschrieben worden, so auch in diesem WALTHARI-Portal. Der an der Universität Konstanz lehrende Politologe Ph. Manow erkennt denn auch in der heutigen Demokratieform Züge einer Wiedergängerin der verblichenen Monarchie (in: ›Im Schatten des Königs. Die politische Anatomie demokratischer Repräsentation‹, 2008). Deren macht leitete sich bekanntlich vom Gottes-Gnadentum ab, also von einem unangreifbaren doppelten Oben. Den Ersatz der vertikalen durch die horizontale Legitimation nach dem Motto »Was alle berührt, muß auch von allen gebilligt werden« (Papst Bonifaz VIII. im Jahre 1294!) haben die Parteien immunstrategisch pervertiert.
Gewiss, in direkten Demokratien geht es in der Politik bedächtiger und durchaus auch fehlerhaft zu. Entscheidungsprozesse dauern oft länger, wodurch aber Fehlentscheidungen drastisch reduziert werden, wie Schweizer Untersuchungen ergaben. Denn nicht mehr nur Politiker diskutieren unter sich (im Parlament, in Ausschüssen und im Fernsehen), Diskussionen finden auch auf breiter Bürgerebene statt, was zum Klärungs- und Legitimationsprozeß entscheidend beiträgt und die Akzeptanz von Entscheidungen erhöht. Nachweislich sind der soziale Friede stabiler, das wirtschaftliche Wachstum höher und der Minderheitenschutz besser als in repräsentativen Demokratien (vgl. die Forschungsergebnisse von Adrian Vatter an der Universität Zürich). Die Pro-Kopf-Kosten der US-Wahlkämpfe belaufen sich auf ein Vielfaches dessen, was vergleichsweise in der Schweiz anfällt. Die Auswirkungen der Wahlversprechungen anläßlich der Bundestagswahl 2009 steigerten die Staatsverschuldung auf 100 Milliarden Euro, also auf 1.220 Euro je Einwohner in einem einzigen Haushaltsjahr. Undenkbar für eidgenössische Verhältnisse.
Eine reine Schutzbehauptung ist die Angstparole der Parteien, in direkten Demokratien würden dem Links- und Rechtsextremismus Tür und Tor geöffnet. Der Verweis auf Hitler setzt auf historische Unkenntnis: Seine Kandidatur zum Reichspräsidenten, der in der Weimarer Republik direkt vom Volk gewählt wurde, scheiterte 1932 kläglich. Im Jahr 1933 war es nicht das Volk, es waren die Parlamentarier, also die Machtinhaber der repräsentativen Demokratie, die mehrheitlich dem Ermächtigungsgesetz zugestimmt haben! Zweimal (1928 und 1929) stieß Hitler mit Volksbegehren auf Ablehnung. Weil direktdemokratische Mühlen langsamer mahlen, werden also weniger politische Fehlentscheidungen getroffen (Einzelheiten dazu in: ›Aktive Bürgergesellschaft in einem gebändigten Staat‹ 2007, vgl. Fenster Sachbücher, Sektion zeitkritische Schriften). Das läßt sich an den Ergebnissen im erwähnten Musterland der direkten Demokratie eindrucksvoll belegen. Dort werden extreme Ausschläge (etwa in Sachen Ausländerfeindlichkeit) plebiszitär korrigiert – ohne parlamentarische Inszenierungen und journalistische Horrorzeichnungen, wie sie in Deutschland an der Tagesordnung sind.
Obschon direkte Abstimmungen weltweit zunehmen, kommt der Prozeß in Deutschland nur mühesam in Gang. Der Grund: Die interne Machtaufteilung im Parteienkartell würde durch direktdemokratische Mitsprache aufgelöst. Daher verteidigen die etablierten Parteien mit Zähnen, Klauen und Schutzbehauptungen ihren privilegierten Status – auf Kosten praktizierter Volkssouveränität. Schon die Direktwahl des Bundespräsidenten, wie es Charles Blankert u.a. vorschlagen (HB Nr. 99/09, S. 8), findet kein öffentliches Echo.
Alle Wahlen machen die Parteien unter sich aus. Unter Parteipolitikern, Journalisten und Verfassungsrichtern herrscht mehrheitlich ein Einvernehmen darüber, daß es schädlich sei, über periodische Wahltage hinaus dem Volk eine direkte Mitsprache einzuräumen. Das entsprach immer schon dem Denken der Mächtigen und Eliten, wie man bei Horaz nachlesen kann (›odi profanum vulgus et arceo‹.). »Mehr direkte Demokratie würde hierzulande nur dazu führen, daß gut organisierte Interessengruppen Mehrheiten für ihre Strategie der Verhinderung zu organisieren wüßten«, hieß es abwehrend in der FAZ (Nr. 193/04, S. 11). Das gleiche Qualitätsblatt beklagt die Parteienmacht anläßlich des ZDF-Skandals um den entlassenen Chefredakteur. Auch der derzeitige Präsident der Bundesverfassungsgerichts, Hans-Jürgen Papier, hält »nicht viel davon, ein Referendum punktuell und einzelfallbezogen für die Ratifizierung des (EU-)Verfassungsvertrags vorzusehen« (HB Nr. 152/04, S.2). Da Verfassungsrichter von den Parteien vorgeschlagen werden, überrascht dieses Votum nicht.
Doch manche Politiker werden wenigstens spät einsichtig, so der ehemalige Ministerpräsident Baden-Württembergs, Erwin Teufel, der als Quintessenz seiner politischen Erfahrungen jüngst notierte: »Für mein Leben wurde die Einsicht prägend, daß die Gemeinde allzuständig ist. Sie ist den Menschen am nächsten.« Die Gemeinde (Polis): Urzelle direktdemokratischer Aktivität. Zurecht lehnt Erwin Teufel den bürgerfernen Vollzeitparlamentarier ab. Dagegen wehren sich die etablierten Parteien mit allen Mitteln der errungenen Systemmacht, deren Gebrauch an die einstige bürgerferne Adelsherrschaft erinnert. An die Stelle des Schutzschildes Gottes-Gnadentum sind reichlich andere Abweisschilder getreten, wie die Praxis des Bundeswahlausschusses belegt. Claus Leggewie kritisierte als renommierter Politikwissenschaftler das wachsende Demokratiedefizit von untern nach oben: An die Stelle des Bürgerwillens treten Parteizirkel, Lobbyisten und NGOs. Es haben sich in der Tat mächtige nationale und internationale Politbürokratien und -netze etabliert, die jeder Legitimation entbehren und dennoch den politischen Ton angeben. Der Bürger kann nur noch ohnmächtig zuschauen; das tägliche Infobombardement soll ihn unfähig und vergessen machen, wer unberufen über ihn herrscht.
Die globale Bilanz direktdemokratischer Bürgerbeteiligungen nimmt sich bescheiden aus. In den rund 200 Staaten der Welt gab es bisher insgesamt nur 1.500 nationale Volksabstimmungen. Etwa tausend fanden in den letzten vierzig Jahren statt, rund 600 davon in Europa, voran in der Schweiz. In Zeiten medienglobaler Totalaufklärung zeugt diese Minimalisierung des Volkswillens für eine unterentwickelte politische Kultur. Während dem Bürger zunehmend tagesaktuelle Einblicke in die politischen Entscheidungsprozesse verschafft werden, wird er zugleich vermehrt entmachtet und entpolitisiert durch die Kartelle von Entscheidungsträgern, die er nicht oder nur indirekt legitimiert hat. Dieser gegenläufige Prozeß führt zwangsläufig zum Konflikt mit explosivem Ausgang. Ein mehrhunderttausendfaches Heer international agierender Machtträger entscheidet über das Schicksal der Erde – ohne ausrechende Bodenhaftung mit den mündigen Bürgern. Es fehlen Legitimationsstränge von unten nach oben. Doch wann schon haben Mächtige daran eine erkennbares Interesse gezeigt?
28. Oktober 2007
Auf der Suche nach dem verlorenen Sie in Zeiten der Du-Seuche
Von Erich Dauenhauer
Ein epochaler gesellschaftlicher Bruch ist zu registrieren, dessen Anfangsrisse vor etwa dreißig Jahren erkennbar wurden und der sich mittlerweile zu einer veritablen Kontinentaldrift in der globalen Sprachlandschaft entwickelt hat. War einst das Du den Nahverhältnissen der Familie und Freundschaft, den Künstler-, Medien- und Sportgruppen vorbehalten, so hat es heutzutage auf breiter gesellschaftlicher Front die Herrschaft angetreten, so rigoros wie gedankenlos, alles einebnend und mit wenig Respekt vor Unterschieden, die dem Einzelnen Luft und Selbstachtung lassen. In der Welt der rasch dahingeplapperten Vornamen, des zischenden Tschüß und der ballernden Hallos gerät das Sie als Distanzwahrer in eine Minderheitsposition, über die selbst in aufgeklärten Gesellschaften der Geruch des Außenseitertums verbreitet wird. So haben sich die Verhältnisse verkehrt. Normalität wird ins Exzentrische umgemünzt und im Brei der wabernden Du-Gemeinschaft an den Rand gedrängt. Aus der differenzierenden Trias der Ansprechformen brach zuerst das wohlig-respektierende Euch (gegenüber älteren, aber vertrauten Menschen außerhalb der Familie) weg, nun geht es dem Sie an den angeblichen Stehkragen, so daß wir bald in einer vollkommenen Hallo-Du-Tschüß-Volksgemeinschaft leben dürfen, in welcher…
Worin besteht der Schaden? Bei Helmuth Plessner konnte man schon vor Jahrzehnten die kommende Verlustbilanz studieren. In seiner philosophischen Anthropologie gehört die »Sehnsucht« nach einem persönlichen Schutzraum zur Conditio humana. Nicht jedermann darf einem auf den Leib rücken, allein schon deshalb nicht, um die Leibbedrücker anzuhalten, sich anständig zu benehmen. Dem Du entgleitet die soziale Hygiene schneller als dem Sie, welches zu Abstand und Anstand animiert. In Heft 20 der Literaturzeitschrift WALTHARI heißt es, daß ein »zwischenmenschlicher Mindestabstand« vor »rigoristischen Zugriffen und schambesetzten Selbstentblößungen schützt und … Aggressionen minimiert« (S. 78). Was in der Küßchen-Branche und unter Parteigenossen du-glatt so leicht in Skandale führt, taugt nicht zum Normalumgang unter selbstbewußten Bürgern.
Wie es im Zeitalter der Du-Seuche zugeht, erlebt man täglich im Fernsehen, im Beruf, im Krankenhaus, im Sport, auf Bahnreisen usw. »Na, wie geht’s uns, Opa«, hört man Pflegerinnen allmorgendlich lautstark sagen, um, ohne eine Antwort abzuwarten, in den Du-Jargon einzuschwenken. Bis zu den sittenbespuckenden Achtundsechzigern, die sich nach ihren Kultur- und Politikvertrampelungen adelsfein herausgeputzt haben (auf toskanischen Landgütern, im lukrativen Beratungs- und Uni-Schaugeschäft usw.), pflegten Studierende ganz selbstverständlich den Sie-Umgang. Heute poltern Erstsemester gegenüber Seniorstudenten auf tiefem Du-Niveau los. Nur noch Spuren vom Zauber der Dezenz und des feinfühligen Takts… »Permissive Nähe wird in den Medien als vorgeblicher Emanzipationsgewinn vor-exerziert…« (WALTHARI-Heft 20). Von den Hochformen des Begegnungseros’ haben sich Wohlstandsgesellschaften verabschiedet. Die glückvollen Formen der Achtungsdistanz und anspielungsreichen Indirektheiten aus Herzensbildung finden nicht einmal mehr in Romanen…
7. Dezember 2008
Gabriel Marcel
geb. am 7. Dezember 1889 in Paris, gest. am 8. Oktober 1973 in Paris
Wird als katholischer Existenzialist bezeichnet, er selber verstand sich als Neosokratiker oder als Vertreter des »christlichen Sokratismus«, weil er den Menschen nur Fragen stellen, aber keine Überzeugungen aufdrängen wollte. Glaubte entgegen christlicher Lehre an Seelenwanderung (›Homo Viator‹). Stark beeinflußt von Bergons Philosphie. Empfand eine Seelenverwandtschaft zu Proust (beider Mütter waren Jüdinnen, beider Väter Katholiken). Cartsianische Ansichten in ›Sein und Haben‹ (1934), worin zwischen Außen (Objekte) und Innen (Subjekt) streng getrennt wurde. Überwindung des Dualismus nur durch das persönliche Bewußtsein. Arbeitete als Musik- und Theaterkritiker, schrieb Theaterstücke (u.a. ›Le monde cassé‹, 1933). Thema: Verlust des Sakralen und der kulturellen Identität infolge hybrider Technifizierungen (›Les hommes contre l’humain‹, 1951). Einsamkeit als existenzielle Grunderfahrung, die durch die Moderne noch verstärkt werde, weil diese mit Objekten das Transzendente verstelle. Denn Sein entstehe nur im Dialog mit dem Transzendenten, womit auch die »Insularisierung« des Subjekts überwindbar werde (›Metaphysisches Tagebuch›, 1927). Erst in der Erkenntnis des Anderen gelinge das Cogito). Es bleibe jedoch ein Geheimnis, wie das gelinge (›Geheimnis des Seins‹, 1951). Obschon Gott wissenschaftlich nicht beweisbar sei, könne man seine geheimnisvolle Existenz im Gebet erleben. Erst in der Erfahrung des »absoluten Du« öffne sich die menschliche Existenz.
© Erich Dauenhauer – Aus: www.walthari.com
22. Februar 2008
Arthur Schopenhauer
geb. am 22. Februar 1788 in Danzig, gest. am 21. September 1860 in Frankfurt/Main
Vertreter der pessimistisch gestimmten Willensmetaphysik. Leben heißt für den Danziger vornehmlich Leiden. 1818 erschien ›Die Welt als Wille und Vorstellung‹. Zentraler Satz: »Die Haupt- und Grundtriebfeder im Menschen wie im Tier ist der Egoismus, das heißt der Drang zum Dasein und Wohlsein.« Damit werden Verstand und Vernunft sekundär. Der unruhige Egoismus neigt zur Selbstzerstörung infolge seiner Gier nach ständig Neuem. Um den destruktiven Willenstrieb zu entlasten, gibt es drei Abhelfer: die Kunst, das Mitleiden und die Resignation. Mitleid wird nicht moralisch gesehen, sondern als eine Form der Selbstfindung. Hinter dem »Schleier der Maja« wird der »Schmerz der ganzen Welt« sichtbar. Der Mitleidende erkennt, daß alles Streben nichtig ist.
Am wirkungsmächtigsten war Schopenhauers Resignationsempfehlung, womit der Wille gebrochen werden soll, um frei zu sein. Das wirkliche Dasein verlangt, »daß wir die Welt abschütteln«. Schopenhauer will sich an der Berliner Universität mit Hegel messen, der großen Zulauf hat, während Schopenhauer sich mit fünf Studenten zufrieden geben muß und die Universitätslaufbahn aufgibt (1831). Aus Berlin flieht er vor der Cholera zunächst nach Mannheim, dann nach Frankuft/Main, wo er ab 1833 bis zu seinem Lebensende bleibt. Im Gegensatz zu Hegel sieht er in der Geschichte keine Vernünftigkeit wirken, wofür er später bei Nietzsche begeisterte Zustimmung findet. Auch an Kants Kategorischem Imperativ, welcher Ethik mit Vernunft begründet, findet der Danziger kein Gefallen. Allein im Mitleid, d.h. mit Blick auf das Wohl des Anderen, erwächst eine moralische Triebfeder, mit der zugleich eine Selbstfindung erreicht wird. Diese Sicht steht in der Nähe der indischen Philosophie (mystische All-Einheitslehre). Schopenhauer war ein glänzender Stilist und Aphoristiker. Im Unterschied zu hochmoralischen Pflichtentwürfen begünstigt er asketische Lebenspragmatik.
»So ist die wahre Lebensweisheit, daß man überlege, wieviel man unumgänglich wollen müsse,
wenn man nicht zur höchsten Asketik, die der Hungertod ist, greifen mag:
je enger man die Grenze steckt, desto wahrer und freier ist man.«
Arthur Schopenhauer
9. Juli 2009
Was Idole anrichten
Zur Michael Jacksons Todesfolge: Der Pomp in Los Angeles und das ihn begleitende weltweite Medienspektakel haben Millionen Menschen in ihren Bann geschlagen, aber noch mehr Millionen ungläubig staunen lassen. Was hierbei ablief, kam für übliche Zeitgenossen aus einer anderen Welt und löste Kopfschütteln aus. Wer je auch nur wenige Minuten einen Jackson-Auftritt beobachtet hatte und über den privaten Hintergrund nur grob informiert war, mußte sich fragen: So große Bewunderung über so viel Verqueres! Über das zur Maske erstarrte Gericht fielen zuvor die Medien her, um nach dem Todesfall globale und lukrative Aufmerksamkeiten einzusammeln, indem sie plötzlich das tief gefallene Szenenidol zum Heiligen und Bürgerrechtler hochstilisierten. Statt stille private Trauer: inszenierte Massenhysterie im Tränenbild einer umgepolten Erinnerung.
Der Fall wäre trotz hypersentimentaler Medienblase kaum der Rede wert, legte er nicht ein Phänomen bloß, das als gesellschaftliche Eruption auf pseudokünstlerischer Rauschbasis bezeichnet werden kann und offenbar weltweit verbreitet ist. Periodisch überschwemmt es die quotensüchtigen Medien, die sich selbst dann beteiligen, wenn sie das idolatrische Phänomen kritisieren. Dabeisein ist alles.
Wer einmal Idolenstatus erreicht hat, bleibt i.d.R. lebenslang süchtig nach diesem Gift der Selbstentfremdung. Doch die Schäden gehen weit darüber hinaus. Sie befallen die Gesellschaft und Politik, sogar das Recht und die Wissenschaften. Opfer der falschen Bewunderung sind beileibe nicht nur Gutgläubige, auch kritische Geister sind dem Idolenbetrieb häufig wehrlos ausgeliefert, weil das System oder die Masse…
Dazu zwei Beispiele, ein historisches und ein aktuelles. Der Imperialist und Menschenverächter Napoleon führte bei seinen Eroberungszügen stets staatlich beauftrage ›Kunstsammler‹ und ›Hofmaler‹ mit sich. Was er zwischen Ägypten, Rußland und Spanien an Kunstschätzen einsammeln ließ, ist in französischen Museen heute noch als Beutekunst zu bestaunen. Schlimmer noch traf es den Historienmaler Antoine-Jean Gros, der auf einem Gemälde von 1804 (›Napoleon bei den Pestkranken von Jaffa‹) eine glatte Geschichtsfälschung beging. Der zynische Imperator hatte die Pestkranken überhaupt nicht besucht, sondern seine erkrankten Soldaten vergiften lassen. Auf dem Ölgemälde berührt der angeblich fürsorgliche Korse einen pestkranken Soldaten mit der linken Hand, ohne Atemschutzmaske wie sein dahinterstehender Begleitoffizier.
Das aktuelle Beispiel bezieht sich auf Altbundeskanzler Helmut Schmidt, den die Medien anläßlich seines 90. Geburtstages verdientermaßen nicht nur gewürdigt haben, sondern zum politischen Helden aufwerteten (nicht nur die ›Zeit‹ mit speziellen Beilagen). Mag es auch dem nüchternen Analytiker Schmidt nicht geheuer dabei gewesen sein, er hat es geschehen lassen und mit zahlreichen Medienauftritten gefördert. Haften geblieben ist nicht allein sein Visionsspruch. Von den Schmidtiaden gingen durchaus auch…
19. August 2008
Altgriechische Bürgergesinnung
Rückbesinnung auf ein Freiheitsmodell als Maßstabsquelle –
Mit seiner Schrift ›Politik und Anmut‹ (2000) glaubte Christian Meier eine ›wenig zeitgemäße Betrachtung‹ (Untertitel) vorgelegt zu haben, doch sollte er sich täuschen. Nachdem ich seine Hauptgedanken in der Schrift ›Aktive Bürgergesellschaft in einem gebändigten Staat‹ aufgegriffen hatte, häuften sich einschlägige Beiträge, ohne daß freilich auf die beiden Anstoßtexte Bezug genommen wurde. Worum geht es? Verkürzt gesagt: um ein bürgerliches Freiheitsbegehren und um Begründungspflichten. Beide Verhaltensweisen entwickelten sich in Griechenland ab dem 8. Jahrhundert zu einem gelebten Gesellschaftsmodell, das den Staat durch direkte Bürgermitsprache kleinhielt.
»Die Bürger Altgriechenlands kämpften nicht allein gegen äußere und innere Feinde, sie kämpften vor allem gegen sich selber, gegen die Versuchungen der Feigheit, Roheit und Ungerechtigkeit. In demokratischen Zeiten vertrauten sie mehr dem Gewicht von Argumenten als auf Gewalt und List…«, führte ich aus und fuhr fort: »Die Griechen kannten keine heiligen Bücher und mußten das gesellschaftliche Kunststück fertigbringen, ihre Identität ästhetisch und lebensphilosophisch herzustellen und zu bewahren. Es war die ›ganz außerordentliche Bedeutung des Ästhetischen‹, das als Klammer wirkte. Charis, die Anmut, konstituierte die Öffentlichkeit und war ›die Grundlage des Zusammenlebens‹ – eine einmalige Soziogenese, wie sie sich weltgeschichtlich seither nicht mehr wiederholte. Es gab weder Oberpriester noch einen zentralen Hof noch unangreifbare Götter. ›Die Griechen kannten auf Erden nichts über sich.‹ Was sie verband, waren Lebensgeschmack und gesellschaftliche Prinzipien (Tugenden). Geachtet wurde, wer in öffentlichen Versammlungen stil- und respektvoll aufzutreten wußte… Die Orestie ist das beste Beispiel dafür« (Zitate im Zitat: Christian Meier).
Weiter schrieb ich: »In gelungenen Poliszeiten waren Gleichheit, Freiheit und Ordnung verwirklicht. Aus alledem entsprang die oft gepriesene griechische Helle, der leichte Sinn (rhathymia) und die kluge Weltneugier, kurz: der Glanz (lamprotes) einer Kultur, die so wenig Nachahmung fand. Meier verschweigt nicht die Schattenseiten dieser glanzvollen Bürgergesellschaft, zu der auch die Sklaverei gehörte. Doch zu den Früchten der griechischen Polisdemokratie zählen die Geburt der europäischen Philosophie, Dichtung und Demokratie. Diese Früchte waren keine Geschenke von Göttern: ›Die Freiheit, der Glanz, die Anmut des griechischen Lebens waren keineswegs einfach ein Geschenk‹, sondern das Ergebnis einer aktiven, freiheitsbewußten Bürgerschaft, die auf Anmut, Mut und Heiterkeit setzte und der Welt ›eine neue Form des Politischen‹ vorlebte, nämlich die aktive Bürgergesellschaft. Teilhabe (an Abstimmungen, Verteidigungsmaßnahmen usw.) war zwingende Voraussetzung. Ihren Staat führten die Griechen am engen Zügel, sie verlangten bei Überschüssen sogar Gelder zurück« (Quelle: ›Aktive Bürgergesellschaft in einem gebändigten Staat‹, Münchweiler 2007, S. 71 ff.).
Im Merkur-Heft 10/2007 erinnerte Christian Meier erneut an das Griechenmodell: »Diesen Griechen lag sehr viel daran, in kleinen selbständigen Gemeinwesen zu leben. So haben sie auch, als der Raum für die wachsende Bevölkerung zu eng wurde, kaum daran gedacht, ihren Nachbarn Land wegzunehmen, sondern weit in der Ferne neue, wiederum kleine selbständige Gemeinden gegründet. Sie haben überhaupt vergleichsweise sehr wenig Wert darauf gelegt, Eroberungen zu machen oder gar andere in ihren Verband aufzunehmen. Das hätte sich nicht mit dessen Charakter vertragen… Gemeinwesen – das waren sie alle zusammen, ganz konkret und unvermittelt. Die zentralen Instanzen, die sie brauchten, sollten möglichst wenig eigene Macht haben. In voller Körpergröße, so wie sie waren, wollten sie das Ganze des Gemeinwesens selber ausmachen. Das hieß auch: Jeder sollte sich möglichst allseitig ausbilden, für alles befähigt sein. Kein Gedanke an all die Unterordnungen, Spezialisierungen, Abhängigkeiten, die heute dazu tendieren, alles im Staat kleinzumachen, die Einzelnen auf Funktionen zu beschränken und zu instrumentalisieren. Vielleicht kann man sagen: Die Gemeinwesen sollten klein sein, damit die Zugehörigen möglichst groß sein konnten« (S. 939 f.; Hervorhebung: E.D.).
Wenn die Polis in Not geriet, beauftragten die Bürger einen der Ihren, um das »Gemeinwesen wieder ins Lot zu bringen. Wer damit betraut war, konnte wie ein Monarch wirken, wenn es galt, akute Mißstände zu beheben. Andererseits mußte er, in Hinblick auf die Zukunft, sich selbst wegdenken. Die Gemeinwesen – anders gesagt: die verschiedenen Kräfte in ihnen – sollten ja befähigt werden, sich selber zu halten; in der richtigen Balance« (S. 943; Hervorhebung: E.D.). Für Solon von Athen war Maßhalten (mäte lian) der Schlüssel zur rechten Ordnung. »Die Mahnung, maßvoll zu sein, hatte das Delphische Orakel mit aller Macht den Griechen eingeschärft. … Man kann es kaum anders verstehen denn als Ausdruck der Tatsache, daß, wo kein Subjekt herrschen soll, die Suche nach einem Objektiven, nach dem Maß, das Korrelat der Freiheit ist. Gewiß, ohne spezifische Maßverhältnisse geht es auch anderswo nicht. Aber hier scheinen sie geradezu existentiell gebraucht worden zu sein. Es scheint, daß in diesem vielfach so maßlosen Volk geradezu im Übermaß nach dem Maß gestrebt worden ist – auf der ganzen Skala kultureller Äußerungen« (S. 944).
Davon und von den weiteren Merkmalen der griechischen Gesellschaft sind die heutigen Wohlfahrtsstaaten mondweit entfernt. Eine Wende könnte man nur »aus der Mitte der Gesellschaft« erhoffen, doch der Parteienstaat hält alle Bürgerlichkeit nieder und verengt Zug um Zug die Freiheitsräume. Kurz gesagt: zu viel Staat, zu wenig Gesellschaft. Was wir haben, sind systemwendige Politiker in »grauen Anzügen«, also Mittelmaß. In den überbelichteten Hybridräumen der modernen Medien ist bürgerliche Agora-Kommunikation unmöglich. Das »Modell einer in die Zivilgesellschaft eingelassenen Politik« gehört nach Wieland Elfferding »längst zum Gerümpel«.
29. November 2008
Teil 20 der Tugendbeschreibungen: Großmut, Hochherzigkeit, Freigebigkeit
Dr. E. Dauenhauer
Diese drei Geschwister des guten Herzens hat die postmoderne Gesellschaft ins Exil geschickt. Großmütig zu sein gilt heutzutage eher als Schwäche denn als Tugend. Von Hochherzigkeit wagt kaum noch jemand zu sprechen, weil schon das Wort altväterlich klingt. Und freigebig? Wer ist heutzutage noch freigebig, d.h. geberfreudig, ohne dazu von außen gedrängt zu werden (so häufig an Weihnachten usw.)? Ich will die drei vergessenen Tugenden begriffsgeschichtlich aus dem Exil holen.
Großmut. Schon bei den Griechen war Megalopsychia (Großherzigkeit, hohe Gesinnung) eine häufige Begleiterin tapferer Helden (bei Homer). Demokrit erweiterte den Wortsinn um die Charakterstärke, »Taktlosigkeit gelassen zu ertragen«. Demostenes rühmte die großmütige Gesinnung der Griechen, und Platon sah aus der Megaloprepeia (Großartigkeit) die gewünschte Philosophenkönige hervorgehen. Erst Aristoteles hat in seinen beiden Ethiken (Eudemische und Nikomachische Ethik) den Großmut systematisch in den Tugendkreis eingefügt und weist ihm einen Platz in der rechten Mitte zwischen Kleinmut (Mikropsychia) und Aufgeblasenheit (Chaynotes) zu. »Der wahrhaft Großmütige muß gut sein« er sei über alle Ehre erhaben. Er handle bei Gefahr todesmutig und könne sich durch Selbsterkenntnis vor Hochmut schützen. Damit war das Inhaltsprogramm für die weitere Antike, für das gesamte Mittelalter und für die Neuzeit vorgegeben. Die Stoiker übernahmen die erhabene Haltung (Ataraxie) gegenüber Gut und Böse, ebenso Epikur; für ihn war Großmut ein Kennzeichen des Weisen. Cicero und Seneca folgten dieser Deutung, die mit Beginn des christlichen Mittelalters um die Milde erweitert wurde (bei Ambrosius). Großmut wird vor allem als Tugend des Herrschers gesehen, der Gnade vor Recht ergehen läßt. Einhart und Alkuin z.B. lobten an Karl dem Großen nicht nur seine Tapferkeit, sondern auch seinen Großmut und konnten sich dabei auf den christlichen Tugendkanon berufen (Demut, Milde, Nächstenliebe usw.). Die griechische Makropsychia wird als lateinische Magnanimitas geläufig (große Seele). Dabei beruft man sich auf Aristoteles und die Stoiker ebenso wie auf die Bibel und die Kirchenväter. Was zwischen Gott und den Menschen die göttliche Gnade, das ist für den Christen die großmütige Seelengröße dem Nächsten gegenüber. Tapfer zu sein hat man nun auch im Leiden. Abaelard verbindet den Großmut mit Ausdauer, Tapferkeit, Gerechtigkeit und Mäßigung und steht damit ebenso in aristotelischer Tradition wie Bonaventura, der dazu ermunterte, im Vertrauen auf Gott Großes zu wagen und es demütig zu verwalten. In solche Seelengröße strahle das göttliche Gnadenlicht ein. Besonders Märtyrer sind leidenstapfer und großherzig im Vergeben ihrer Peiniger. Durchgehend, von der Antike über das Mittelalter bis zu Beginn der Neuzeit, wird Großmut in Gesellschaft von Tapferkeit und Demut gesehen. Ohne diesen Tugendverbund würden das vernunftgemäße Gute und ein erfülltes Leben verfehlt. Es blieb dem Gang der Neuzeit vorbehalten, der Magnitudo animi in den lebenspraktischen und ethischen Schatten zu stellen. Der Renaissancemensch war stolz, nicht demütig-großherzig, ebenso das in den Städten aufkommende Bürgertum. Der herrschende Adel in absolutistischer Gestalt gab sich über- und hochmütig und die nachfolgenden Mystagogen martialisch. Im ›Handbuch Ethik‹ (2006, rezensiert in diesem WALTHARI-Portal) kommen Großmut und Demut nicht einmal mehr als Stichwort vor. Diese altehrwürdigen Tugenden sind also vergessen. In Politik und Gesellschaft sieht es danach aus…
Hochherzigkeit. Sie ist die nächste Verwandte zum Großmut, wie sich allein schon aus der teilweisen Wortgleichheit im Griechischen und Lateinischen ergibt (Megalopsychia, Magnitudo animi). Im Deutschen gruppieren sich Hochgemutheit, Hochsinn und Seelengröße um diesen Begriffssinn, den Polybios an der altrömischen Nobilität und Thomas von Aquin am wahren Christenmenschen ausmachten. Hochherzigkeit wurzelt wie Großmut in rechter Selbsteinschätzung, unterscheidet sich aber von diesem dadurch, daß sie auch ohne Tapferkeit zu denken und praktikabel ist. Dafür sorgt die Demut. Zum großen Mut gehören Weitblick und Standhaftigkeit, zum großen Herzen die aufnehmende Hinneigung zum Nächsten. Großmut verzeiht, großherzig muß man helfen…
Freigebigkeit. Auch Eleutheriotes steht in naher Verwandtschaft zum Großmut, nimmt aber in der altgriechischen Tugendlehre keine zentrale Rolle ein. Nach Aristoteles hat der Freigebige (Eleutherios) auf Gerechtigkeit zu achten und freudig zu geben (Nikomachische Ethik, Ziffer 1119 b 22 ff.). Die innere Haltung gebe das rechte Maß vor. Bei den Römern steht Liberalitas für den Begriffssinn. Für Cicero ist derjenige freigebig, der mit Wohlwollen (Gratuia) gibt, ohne auf eigenen Vorteil bedacht zu sein (De officiis, I, 15, 48). Einem Vir bonus gegenüber ist Freigebigkeit allerdings unschicklich! Cicero warnt vor dem Mißbrauch der Freigebigkeit und denkt dabei an Caesars Volksfütterungen aus Machtgründen. Ambrosius kann sich auf den 2. Korintherbrief berufen, der den freudigen Geber lobt. Das althochdeutsche Milti (Milde) berührt insofern die Freigebigkeit, als damit die Belohnung des Königs gegenüber seinen Gefolgsleuten bezeichnet wurde. Vom Herrscher erwartete man großzügige Zuwendungen für tapfere Dienstleistungen. Thomas von Aquin definiert Freigebigkeit so (in: Summa theologica, II/II): »Der Freigebige kann loslassen. Daher darf man sein Tun auch weitsinnig nennen, denn was weit ist, hält man nicht an sich, sondern gibt es weg. Darauf zielt der Ausdruck Liberalitas. Gibt nämlich jemand etwas von sich weg, entläßt er es aus seiner Obhut (Custodia) und Herrschaft (Dominio) und zeigt, daß sein Herz nicht mehr daran hängt.« In N. Hartmanns Ethik (1925) wird Freigebigkeit nur noch unter den aristotelischen Tugenden nebenbei erwähnt. Danach gänzliches…
Wer heutzutage an diese drei einst hochgeschätzten Tugendtrias erinnert und für ihre Rückkehr aus dem Exil plädiert, muß mit Kopfschütteln rechnen. Zugreifen, jeden Vorteil ausnutzen lautet die Devise in einer herzkalt gewordenen Gesellschaft, die von politischer Machtgier und von einer quotenversessenen Medienoligarchie in Beschlag genommen wird und den inneren Zusammenhalt verloren hat, weil Großmut, Hochherzigkeit und Freigebigkeit als Kitt abgebröckelt sind. Nicht einmal in ethischen Lehrbüchern wird ihrer gedacht, geschweige denn, daß sie zwischenmenschlich praktiziert würden. Postmoderne Helden sind weder tapfer noch demütig, daher…
Vom 6. Dezember 2007
Hayek, Fr. A.: Der Weg zur Knechtschaft
Olzog Verlag, München 2007, 323 Seiten, 39,- Euro
Es handelt sich um die Prachtausgabe eines Jahrhundertbuches, dessen Herausgabe von der Friedrich-Naumann-Stiftung gefördert wurde. Hayek war ein scharfer Gegner aller sozialistischen Varianten und ein Antipode zu John M. Keynes, der dem Staat auch ökonomische Lenkungsaufgaben über die Rahmensetzung hinaus zubilligte. Das Buch wurde 1944 verfaßt und ist allein schon deshalb aktuell geblieben, weil planwirtschaftliche Gesinnungen die politische Szene nicht nur in Deutschland beherrscht. »Den Sozialisten in allen Parteien«, dieses Motto schrieb der Nobelpreisträger ins befleckte Stammbuch der Staatsgläubigen. Für Hayek wäre die gegenwärtige Bundeskanzlerin und ihr gesamtes Kabinett ein ›sozialistischer Haufen‹, der vergessen habe, daß (1) jeder Planwirtschaft die Tendenz zum Totalitarismus innewohne und (2) daß staatlicher Dirigismus (so im Gesundheits-, Bildungswesen usw. auch heute wieder) bestenfalls drittbeste Ergebnisse zeitigt, meistens aber auf desaströse Ressourcenvergeudung hinauslaufe. Man lese die aktuellen Parteiprogramme der CDU und SPD und zwischendurch in Hayeks Klassiker: Den ›Weg zur Knechtschaft‹ hat das feige und denkfaule Bürgertum (vgl. I. Kant) erneut angetreten, unter Verhältnissen des Überwachungsstaates, dessen Greifarme bald auch private Rechner erfassen werden. Fünfzehn Kapitel laden zum Lesen ein, darunter ›Die große Illusion‹, ›Die angebliche Zwanghaftigkeit der Planwirtschaft‹, ›Planwirtschaft und Demokratie‹, ›Planwirtschaft und Totalitarismus‹ (besonders lesenswert) und ›Sicherheit und Freiheit‹. Für Hayek gehört es zum politischen Täuschungskanon, den Zusammenhang zwischen Wirtschaftsdirigismus und politischer Diktatur zu bestreiten. Nur in einer Übergangsphase sehe es so aus, als ob das Politische unberührt bleibe. Hayek hat alle historischen und aktuellen Belege auf seiner Seite, wenn er feststellt, »daß alles, was sich, wie die Planwirtschaft, nur auf unsere wirtschaftlichen Interessen auswirkt, die höheren Lebenswerte nicht ernstlich in Mitleidenschaft ziehen könne« (122). Für Deutschland verheißt das nichts Gutes. Ich habe dem politischen Konzept Hayeks in ›Aktive Bürgergesellschaft in einem gebändigten Staat‹ (2007; vgl. Fenster Sachbücher) ein eigenes Kapitel gewidmet. Was besonders betrübt: Trotz aller Erkenntnisse und Erfahrungen macht die Politik die alten Fehler, und das feige Bürgertum (vgl. WALTHARI-Heft 32) fällt darauf herein.
Vom 29. Januar 2007
Teil 13: Klugheit
1
Friedrich Schiller hat in seinen ›Ästhetischen Briefen‹ das Modell eines Bürgerstaates entworfen, worin dem anmaßenden »Kaltsinn« repräsentativer Herrschaft dadurch vorgebeugt werden sollte, daß die Bürger mit festem Charakter, also selbstbewußt und tugendhaft, auftreten sollen. Keine republikanische Gesinnung ohne Charakterbildung – so die politische Botschaft in seinen ›Ästhetischen Briefen‹. Damit lebt, ganz im Sinne der Aufklärung, das ganze Programm der Tugendhaftigkeit auf, das in der griechischen Antike schon breit dargelegt (so in der ›Nikomachischen Ethik‹ von Aristoteles) und über die Jahrhunderte weitergetragen wurde. Wenn beispielsweise in unseren Tagen ein Buch mit dem provokanten Titel ›Disziplin‹ auf den Bestsellerlisten ganz oben steht, zeugt das indirekt von einer Tugendlücke, die nicht nur in Schulen als besonders schmerzlich empfunden wird. Der altgriechische Ursprungssinn von Askese (übende Tüchtigkeit, Selbstdisziplin) wies bereits auf die große Bedeutung dieser charakterlichen Seite hin, ohne welche die Polisgemeinschaften nicht hätten überleben können.
2
Am 19. Juni 2003 ist unter dem Titel ›Privatheit und Askese‹ diese Tugendseite hier vorgestellt worden. Zuvor beschäftigten sich die Beiträge in diesem WALTHARI-Fenster mit Gelassenheit, Redlichkeit, Bescheidenheit, Standhaftigkeit, Besonnenheit, Tapferkeit, Dankbarkeit und Ma’at (tiefer Richtungssinn). In den Jahren 2004 und 2005 waren Hochherzigkeit, Dezenz und nochmals Askese die Themen. Heute nun eine weitere Kardinaltugend: Klugheit. Die Griechen nannten sie Phronesis oder Sophrosyne und die Römer Prudentia. Im Mittelhochdeutschen taucht sie als ›Kluchheit‹ auf. Mit der Wendung ›kluoc‹ deckte um das Jahr 1150 der Dichter Wolfram von Eschenbach eine breite Sinnpalette ab: (1) fein, zierlich und zart, (2) aber auch gewandt und glatt, (3) schließlich listig und gescheit. Begriffsgeschichtlich sind davon bis heute die beiden letzten Sinnstränge übrig geblieben. Klugheit ist zwischen verständigem Wissen um das Richtige und weisheitlicher Übersicht angesiedelt. Der Kluge weiß sich durchzuschlagen, er kann sich ebenso gewandt wie gescheit geben und kennt durchaus die Versuchung der List. Die Ethiklehren lassen allerdings keinen Zweifel: Keine sittliche Grundhaltung ohne Klugheit, denn mit ethisch-naivem Purismus ist nicht durch die Welt zu kommen. Dem Gutgesinnten ist also aufgetragen, klug, d.h. ebenso prinzipienfest wie situativ-gewandt, seine Ziele zu verfolgen.
3
Darauf hat schon Aristoteles (a.a.O.) hingewiesen, wenn er die Klugheit über alle Verstandestugenden stellte und sie zur Handlungsmaxime erhob. Sie sei weder mit Gerissenheit noch mit reiner Verstandestätigkeit zu verwechseln, vielmehr ein praktischer Lebenssinn (Sophrosyne) »mit Bezug auf menschliches Gut und Übel«. Im Unterschied zur Schlauheit, die auch rein Böses anstreben könne, orientiere sich Klugheit stets am Guten. Diesen sittlichen Hintergrund sieht auch Thomas von Aquin: »Prudentia dicitur genetrix virtutum« (die Klugheit ist die Gebärerin aller Tugenden). Das bedeutet nichts weniger, als daß keine andere Tugend (Gerechtigkeit, Standhaftigkeit usw.) ohne Klugheit praktikabel ist: »Omnes virtus moralis debet esse prudens«, jede Tugend ist notwendig klug – oder stumpf, möchte man hinzufügen. Das liegt am Augenmaß und Wissen, die zum Kern der Klugheit gehören. Nur deren Ratio practica läßt den Menschen nicht an der widrigen Wirklichkeit scheitern. Thomas hat eine ausgefeilte Tugendlehre entwickelt, zu deren festem Bestand u.a. Gedächtnis (memoria), Umsicht (circumspectio), Gelehrigkeit (docilitas), Geschicklichkeit (sollertia) und Vorsicht (cautio) rechnet. Der Kluge sinnt stets über die richtigen Mittel und Wege nach, läßt sich beraten und handelt mit Scharfsinn.
4
Das Klugheitsbild war mit Thomas von Aquin faktisch ausgemessen. Was folgte, waren Variationen und Farbverschiebungen der Pudentia, so bei N. Machiavelli, dessen kluger fürstlicher Machtgebrauch ins Verwegene gleitete, so auch bei den französischen Moralisten (Chamfort u.a.), die zur schlauen Galanterie neigten. Erst Chr. Thomasius knüpfte an den antiken und thomistischen Klugheitsbegriff wieder an, wenn er forderte, Klugheit sei an das Gute zu binden und lehre die Wahl der rechten und gerechtfertigten Mittel. Selbst die Liebe hat bei Thomasius klug zu sein (»amor est prudentia«). Bei Kant zählt die Klugheit zu den Postulaten der praktischen Vernunft. Klugheit erteile Ratschläge zum persönlichen und sozialen Glücklichsein (Eudämonie). »Das Wort Klugheit wird in zwiefachem Sinn genommen, einmal kann es den Namen Welt-Klugheit, im zweiten den der Privat-Klugheit führen. Die erste ist die Geschicklichkeit eines Menschen, auf andere Einfluß zu haben, um sie zu seinen Absichten zu gebrauchen. Die zweite [ist] die Einsicht, alle diese Absichten zu seinem eigenen dauernden Vorteil zu vereinigen. Die letztere ist eigentlich diejenige, worauf selbst der Wert der ersteren zurückgeführt wird, und wer in der erstern Art klug ist, nicht aber in der zweiten, von dem könnte man besser sagen: er ist gescheit und verschlagen, im Ganzen aber doch unklug« (›Grundlegung zur Metaphysik der Sitten‹, 2. Abschnitt, Fußnote).
5
Im Laufe der Moderne und vor allem aber in der Nachmoderne hat der Klugheitsbegriff eine dramatische Abwertung erfahren. Schon bei M. Scheler fand eine Verschiebung von der ethischen Tugendhaftigkeit zur bloßen Situationsgewandtheit statt (vgl. Pieper, J.: ›Traktat über die Klugheit‹, 6. Auflage, 1960). Endgültig moralisch abgewirtschaftet hat ein Klugheitsverständnis, das eine gewitzte Cleverneß und Gerissenheit als klug ausgibt. Damit wird jede Verbindung mit dem Guten und Vornehmen, mit Wahrhaftigkeit und Dezenz gekappt. Die moralische Verdunkelung der Nachmoderne (überbordende Kriminalität, Korruption usw.) hat den Verlust der Tugenden zur Ursache, angeführt von der utilitaristischen Aushöhlung der im Gutsinn verwurzelten Klugheit. Sie ist zur abzockenden Vorteilsverschaffung mißraten und kann dafür sogar öffentliche Anerkennung ernten. Was sind das für Zeiten, da der Gerechte für dumm, der Dezente für naiv-schüchtern und der Dankbare für altväterlich angesehen wird? Doch auch dieser verwilderten Dekadenz (vgl. WALTHARI-Heft 48) schlägt irgendwann die finale Stunde.
Vom 24. Oktober 2005
Das verachtete Tugendquartett
Bescheidenheit, Dezenz, Bedürfnisbeschränkung, Askese –
Dr. E. Dauenhauer
Obschon dieses Tugendquartett zum Überlebensprogramm in einer entfesselten Postmoderne gehört, wird es weit häufiger verachtet als geschätzt und noch seltener praktiziert. Ob im Privaten, in Unternehmen oder im öffentlichen Raum der Medien und Politik: wer in bescheidenem und dezentem Stil auftritt, gilt als Schwächling, als unterentwickelte Figur aus der Vormoderne. Im Privaten schon fegen die Du-Seuche und die lauttönende Rabulistik alles beiseite, was aus dem kostbaren Magazin der Dezenz zum geistvollen und eleganten Lebensstil angeboten wird. In Unternehmen dominieren die sog. Durchsetzungstypen; bereits Trainingsprogramme für Vorstellungsgespräche stellen auf Egostärke ab, auf ein Selbstbewußtsein also ohne Schwächezugeständnis. Was sich schließlich im medialen und politischen Raum öffentlich präsentiert, kann geradezu als alltägliches Verachtungsspektakel vor den Toren des Tugendquartetts bezeichnet werden. Der kläglich gescheiterte Bundeskanzler Gerhard Schröder, Gitterrüttler und auch sonst mit tribunenlautem Gehabe, darf als aktuelle Aufgipfelung eines unbescheidenen Politikstils betrachtet werden, der mit Dauergeklapper von seiner Maß- und Realitätsferne ablenken wollte. Schröderistische Indezenz gilt als schick und ist erfolgreich, zumal die Medien dem pathologischen ›Charme der Überdehnung‹ einen hohen Unterhaltungswert zubilligen. Im Sport gar beherrschen Schreihälse weitgehend die Szene, und selbst in Wissenschaft und Kunst wird Bescheidenheit bestraft: durch Nichtbeachtung. Die Kultur der gekonnten Andeutungen und des gehaltvollen Stils kann in der rasenden Postmoderne der schweren Substanz einer Sache keine Geltung mehr verschaffen. Darin liegt die Hauptkrankheit der westlichen Spätneuzeit. Denn Substanzialität gedeiht am prächtigsten im stillen Garten des Tugendquartetts. Es ist mehr als nur ein lebensphilosophisches Mißverständnis, wenn Bescheidenheit, Dezenz, Bedürfnisbeschränkung und Askese als Schwächeprogramm gebrandmarkt werden. Schon die dramatisch unbescheidene Auszehrung von Umwelt und Natur sollte die Verächter der Tugendquadriga in Scham versinken lassen (das Tugendquartett ist durchaus auch als Quadriga zu sehen: die vier Tugenden ziehen den gleichen Substanzwagen).
Bescheidenheit: Unter den drei begriffsgeschichtlichen Bedeutungen ist der Sinn von discretio (fein gebildet, von höfischem Takt) ebenso verloren gegangen wie der Sinn von Bescheidwissen, Einsicht und Erkenntnis ((Luther übersetzte noch das griechische Gnosis mit Bescheidenheit: in 2. Petr. 1,5.6). … Bescheidenheit als bürgerliche Tugend, ohne die das Gemeinwesen keinen Bestand haben kann. Für Bollnow zählt die Bescheidenheit zur »einfachen Sittlichkeit« (so auch sein Buchtitel 1947), die von jedem verlangt werden könne. Diese Bedeutung knüpft an Ciceros modestia und an die frühbürgerliche Auffassung an, wonach Ansehen und Glück sich aus geziemender Zurückhaltung speisen, welcher jede Übertreibung fremd ist (vgl. Schwenk: ›Bescheidenheit‹, in: Hist. Wb. d. Ph., Bd. 1, Sp. 837 f.).
Dezenz: Der lateinische Ursinn hat sich bis heute erhalten. Decens bedeutet schicklich, anständig, reizend und anmutig; es leitet sich von dem Verb decedere ab, das auch den Sinn von sich zurückziehen, sich zurückhalten oder zurückstehen haben kann. Dezenz gehört zu den knappsten und damit kostbarsten Lebensstilmerkmalen, die auf einen gefestigten Charakter und kontrollierten Geist schließen lassen. Äußere Signale sind an (dezenter) Kleidung und Wortwahl sowie an souveräner Geduld erkennbar. Dezente Naturen haben den Blick frei für das Wesentliche. Es sind zugleich Meister im stillen Beobachten von (angeblichen) Nebensächlichkeiten und von Verdrängtem. Als unaufdringliche Zeitgenossen wissen sie genau, wann sie schweigen und was sie reden müssen sowie wann es sich schickt zu gehen. Schon aus dieser Kurzcharakterisierung ergibt sich: Dezente Geister sind Gegentypen der gängigen Ego- und Medialtrommler und schon als bloße Erscheinung das schlechte Gewissen der tellurischen Schandbetreiber.
Bedürfnisbeschränkung: Bedürfnisse sind sowohl das Movens der biologischen Evolution als auch der kulturellen, sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung. Zur Bedürfnislehre tragen die Philosophie und mehrere Wissenschaften (Psychologie, Ökonomie u.a.) wertvolle Erkenntnisse bei. So etwa vermittelte die historische Schule der Nationalökonomie die Einsicht, daß Bedürfnisse keine absoluten Größen sind, vielmehr vom »Klima, der Landessitte, dem Kulturstand, der gesellschaftlichen Stellung« abhängen (Karl Bücher: ›Die Entstehung der Volkswirtschaft‹, Bd. 2, 8. Auflage, 1925, S. 339). Nach Nietzsche sind es »unsere Bedürfnisse, die die Welt auslegen; unsere Triebe und deren Für und Wider«. Nun entspricht es schon der bloßen Lebenserfahrung, daß unsere Bedürfnisse ins Grenzenlose steigen können; beschränkt wird diese Neigung z.B. durch mangelnde Kaufkraft. Seit Anfang der Kulturentwicklung ist Bedürfnisbeschränkung ein Hauptanliegen von Religionen, Gesetzen, sozialen Regeln und Lebensphilosophien. …
Schon Aristoteles hat solche Kasteiungen verurteilt und mit seiner Mesoteslehre für das rechte Maß plädiert (in: ›Nikomachische Ethik‹). Diese Linie der kontrollierten Bedürfnisentfaltung übernahm die römische Stoa (besonders Seneca: vgl. seine kurzgefaßte Lehre in: ›Weisheitliche Lebensführung‹, S. 118-122; Bibliographisches dazu unter Fenster Sachbücher in diesem WALTHARI-Portal). Beherrschungsversuche der grenzenlosen Bedürfnisneigungen durchziehen als kulturelles Anliegen die gesamte Menschheitsgeschichte und kennzeichnen als mißlungene Anstrengungen die postmoderne Gegenwart. Der westliche Wohlstand beruht zweifellos auf einer bedürfnisentgrenzten Ausbeutung natürlicher Ressourcen, die in Teilen nicht erneuerbar sind. Mißlungene Bedürfnisbeherrschungen sind neben dem Materiellen zuhauf auch im kulturellen, sozialen, medialen und psychischen Bereich zu beobachten. Die sog. sexuelle Befreiung ab dem letzten Jahrhundertdrittel hat gewiß auch zur Entgrenzung in Ehe und Familie beigetragen. Seinen Bedürfnissen freien Lauf zu lassen gilt als persönliche Reife und Ausdruck wahrer Freiheit. Demgegenüber erweisen sich Bedürfnisbeschränkungen im Bereich der Umwelt und Natur, in der wirtschaftlichen, persönlichen usw. Entfaltung nicht allein aus Knappheitsgründen als notwendig, sie sichern auch als freiwillige Maß-Gabe das kulturelle Fundament im privaten und öffentlichen Raum. Es sind die Überschreitungen dieser selbstgewählten Maß-Gabe, welche die Moderne und Postmoderne bis ins Mark erschüttern und zu den bekannten Aus-Wüchsen und Verwilderungen führen. Jede bedürfnisentgrenzte Zeit trägt den Keim einer vorzeitigen Selbstauflösung in sich.
Askese: Dieser Teil des Tugendquartetts wird am meisten mißverstanden, weil im modernen Wortsinn der ursprünglich semantische Raum verkürzt bleibt. Das griechische askeo bedeutete: bearbeiten, sich technisch oder künstlerisch verfeinern. Bei Xenophon, Platon und Epiktet wurde daraus: sich leiblich und geistig ertüchtigen durch gymnastische Übungen und zuchtvolle Lebensweise. Im Weisheitsverständnis Platons war jede Tugend (1) tief zu begreifen und (2) beständig zu üben (Gorgias, Ziff. 527). Besonders der Übungsaspekt, die Askese also i.w.S., prägte das Vorbereitungsprogramm der Athleten für die Olympischen Spiele, die auf eine jahrhundertealte Tradition zurückblicken konnten: In der athletischen Lebensweise drückte sich Askese im zugespitzten Sinne aus, sie bedeutete nicht einfach Verzicht auf übliche Gewohnheiten wie Weingenuß, vielmehr bestand sie aus einem körperlichen und mentalen Übungsprogramm, das auch eine stärkende Ernährung mit einschloß. Aus der athletischen Askese hat dann die Stoa eine ganze Lebensphilosophie gezimmert: Weisheitliches Leben gelingt danach nur in der Beherrschung der Gedanken und Triebe, was ohne beständiges Üben nicht möglich ist. … Bei Nietzsche führt der Weg zur »goldenen Natur« des Übermenschen über Beherrschung (egkrateia); und Bemühung (askäsis); vgl. WALTHARI-Heft 45: Zagreus-Mythos). Die neuzeitliche Begriffskarriere schlechthin geht auf Max Webers innerweltliche Askese zurück: Der Geist des globalisierenden Kapitalismus ist danach calvinistischen Ursprungs; tüchtiger Erwerb und Sparsamkeit gelten als Erweis gnadenhaften Auserwähltseins (›Wirtschaft und Gesellschaft‹, 4. Auflage, 1956, S. 315). Sieht man von religiös motivierten Vereinseitigungen (vor allem im Christentum und Hinduismus) ab, so beinhalten lebensphilosophische Askese-Auffassungen durchgängig folgende Elemente: zuchtvolles (!), beständiges Training von Geist und Körper zum Zweck eines erfüllten Daseins im privaten und öffentlichen Raum. Die erwünschte Stärkung erfolgt über maßvolle Bescheidung (Verzicht auf alles Überflüssige) und tapferes Bemühen. Eine asketische Lebensweise in diesem Sinne ist also keineswegs mit Weltabgewandtheit oder plagebeladener Kasteiung zu verwechseln. Durch die delirierende Postmoderne waten lebensphilosophisch eingestellte Asketen als dezente Kämpfer gegen den Bedürfnisrausch und die Hybris.
Vom 28. Juni 2005
Rückfälligkeiten – eine unterschätzte Verhaltenskonstante
Vor Jahren wurde in diesem WALTHARI-Portal die Ansicht geäußert, daß es für Kenner der menschlichen Psyche und Zivilisation nicht verwunderlich wäre, wenn zu öffentlichen Ehren und Staatsämtern gelangte einstige Sozialrevolutionäre nach dem Verlust ihrer ergatterten Stellung in alte Verhaltensweisen und Gesinnungen zurückfallen würden. Frühe, nur mühesam überdeckte Muster leben bekanntlich schon bei drohendem Machtverlust leicht wieder auf. Dieser Psychosozio-Mechanismus erklärt die Wiederkehr von 68er Mustern mit geändertem Vokabular, aber mit verwandter Gesinnung (statt marxistische Kapitalismuskritik nun neosozialistische Reiche-Kritik usw.). Das Erscheinungsbild der regierenden SPD und der Grünen wird wahrscheinlich nach einem Machtwechsel grundlegend anders sein. Man nennt das euphemistisch die Rückbesinnung auf die Quellen.
Auch in anderen Bereichen ist das Phänomen der Rückfälligkeit als Verhaltenskonstante zu beobachten. Davon wissen nicht allein Strafrichter und Psychiater zu berichten, sondern auch Sozialforscher. Vor mehr als dreihundert Jahren hat Samuel Pufendorf (1636-1694), Professor in Heidelberg, die Menschenrechte der Freiheit, Gleichheit und Solidarität (socialitas) verkündet, also lange vor den Amerikanern (1776) und den Franzosen (1789). Seine welthistorische Leistung (vgl. die Literaturzeitschrift WALTHARI, Heft 24/1995) wird öffentlich so wenig gewürdigt wie seine Korporationslehre. Voraussetzung für Frieden und menschliche Wohlfahrt sind für Pufendorf vertragliche Vereinbarungen auf allen Ebenen: für die Familie, Gemeinde, den Territorialstaat und das Imperium. Bevor Menschen sich vertraglich binden, leben sie, so der Begründer der Menschenrechte, in einem Naturzustand, wo die Stärkeren sich durchsetzen. Erst im Recht (unter Verträgen) unterwerfen sich die Menschen Regeln und Bindungen und gewinnen im Gegenzug Schutz, Wohlfahrt und Freiheit. Typisch für das vor- bzw. außervertragliche Leben seien Streit, Furcht, Armut, Einsamkeit und Zügellosigkeit. Im pactum dagegen, darunter auch der Ehevertrag, erlange man Ehre und Handlungsfreiheit (vgl. De officio hominis et civis, 1673). Der Prozeß der modernen Zivilisation verdankt seine soziale Stabilität wesentlich der Durchsetzung dieser pufendorfschen Vertragstheorie. Bindungen an das Recht, sei es auf der Ebene der Ehe, der Gemeinde oder sonstwo, verschaffen Sicherheit und Freiheit.
Der bis heute unterschätzte Zivilisationsbruch ereignete sich im Gefolge der 68er Wirren. Im pufendorfschen Sinne hat sich seither ein gesellschaftlich und politisch breiter Rückfall in ›rohe Naturzustände‹ ereignet, also in bindungsfreie Formen und Rechtsverachtungen. Der Rückgang der bürgerlichen Ehe infolge Lebenspartnerschaften u.ä. ist dafür ebenso einer der vielen Beweise wie der unfaßbare, auf Unwahrhaftigkeit und Verfassungsverachtung beruhende Antrag eines Kanzlers, ihm nach Art. 68 GG das Vertrauen auszusprechen – mit der öffentlich erklärten Absicht, die Abstimmung zu verlieren! Das ist unwahrhaftig und ein grober Mißbrauch des Art. 68 GG. Nach dem pufendorfschen Rechtskodex bewegen sich die gegenwärtigen Gesellschaften und Staaten zurück in ihre Naturzustände. Zur Bindungsscheu gesellen sich Zukunftsblindheit (etwa durch Kinderlosigkeit). Rückfälligkeiten – eine unterschätzte Verhaltensneigung.
Ergänzungstext: Samuel Pufendorf. Ein vergessener Menschenrechtsdenker,
in: WALTHARI-Portal v. 1. Nov. 2003, Fenster Wissenschaftsforum im Archiv.
Vom 27. Februar 2005
Gabriel, M. A.
Islam und Terrorismus
Was der Koran wirklich über Christentum, Gewalt und die Ziele des Djihad lehrt
Resch-Verlag, Gräfelfing 2004, 269 Seiten, 14,90 Euro
Der Toleranzbegriff westlicher Multikultis macht blind gegenüber existenzbedrohenden Gefahren. Schon vor Jahren wurde in diesem WALTHARI-Portal die Frage gestellt, warum man den Koran so wenig lese und wie man nach gründlicher Lektüre noch annehmen könne, daß Demokratie und Menschenwürde einerseits und der Islam und seine Lebens- und Ausbreitungspraktiken andererseits vereinbar seien. Weil der Koran auch Toleranzstellen aufweist, der Islam keine Einheit darstellt und auch friedliche Richtungen kennt (z.B. die Sufisten), neigen westliche Intellektuelle, Politiker u.a. zu Verharmlosungen und zur Hoffnung auf eine Demokratisierung und koranische Aufklärung. Die Erkenntnis, daß die islamischen Offenbarungstexte, die allerdings als unabänderlich, weil von Gott gegeben angesehen werden, umgeschrieben werden müßten oder einem aufklärerischen Reinigungsprozeß unterworfen werden müßten, wenn Islam und Demokratie kompatibel ›gemacht‹ werden sollen, diese Erkenntnis wird permanent unterdrückt: aus Textblindheit, aus Angst vor politischen Folgen usw. Der Konflikt erweist sich bei gebotener Ehrlichkeit als unauflösbar, weil weder die als gottgegeben betrachteten Texte noch die Fundamentalwerte der Menschenwürde zur Disposition gestellt werden können. Genau davon handelt das angezeigt Buch. Der Autor war Professor für Islamische Geschichte an der Al-Azhar Universität in Kairo, ist also eine authetische Lehrautorität aus der islamischen Welt, die er für unreformierbar hält und deren Gefahrenpotenzial er quellengenau nachweist. Selbst Leser, die sich mit der islamischen Gefahr, die keineswegs nur von Seiten der Fundamentalisten droht, schon näher beschäftigt haben, fallen von einem Schrecken in den nächsten, wenn sie mit fortschreitender Lektüre die Binnenansicht des ehemaligen islamischen Geistlichen, der mit zwölf Jahren den gesamten Koran auswendig wußte und als gelehrter Kritiker später Folter, Gefängnis und Morddrohungen ertragen mußte und enttäuscht zum Christentum übertrag, in aller Offenheit kennenlernen. Gabriel kommt zu dem Ergebnis: Die Djihadstellen des Koran heben die Toleranzsuren mehr als auf; Mohammeds Heiliger Krieg dauert heute noch an; und die Islamisierung der Welt bleibt oberstes Ziel. In 26 Kapiteln wird ein biografisches und islamische Bild gezeichnet, das allen Toleranzutopisten die Augen öffnen sollte; wie sich der kämpferische Islam in Gestalt nicht allein des Terrorismus, sondern auch in der Unterwanderung westlicher Gesellschaften (durch saudi-arabische u.a. Finanzquellen, also aus Geldern westlicher Autofahrer) zeigt, läßt sich fugenlos in die Tradition und die Textgestalt einordnen. Am erschütterndsten sind die Erlebnisberichte des Autors, so etwa wenn er im Kapitel ›Menschenrechte unter dem Islam‹ einen ahnungslosen ehemaligen Baptistenpastor, der zum Islam konvertierte, vor Studenten regelrecht vorführte. Dem Eroberungs- und Missionsziel ist, wie Geschichte und Gegenwart, aber auch Textstellen lehren, kein Mittel fremd: Krieg und Steinigung, Täuschung und Lüge. Solange orthodoxe Muslime in der Minderheit sind, wird ihnen Anpassung bis zur Lehrverleugnung nahegelegt, dürfen und sollen sie täuschen. »Mit Christen und Juden gehen sie um, als wären sie Brüder. Den Islam präsentieren sie diesen Ländern als Antwort auf alle Probleme der Menschheit. Diese verwestlichten Muslime stellen ihre Religion so dar, als stünde sie für Barmherzigkeit, Freiheit, Gerechtigkeit und Versöhnung. Sie porträtieren den Islam als eine Religion, die keine Vorurteile gegenüber Rassen oder Kulturen kennt… Muslimische Gruppen nutzen Friedensgespräche oder Friedensvereinbarungen, um sich Zeit zu verschaffen, damit sie neue Pläne schmieden, Vorbereitungen treffen und sich für den Sieg positionieren können. Muslimische Militärführer sagen der anderen Seite, was immer sie hören will, um Zeit zu gewinnen, doch wenn es dann darum geht, die Zusagen einzulösen, sieht die Geschichte ganz anders aus… Schauen wir uns an, wie Mohamed mit Lügen umging, denn sein Verhalten ist Teil der Grundlage des islamischen Gesetzes… Der Erste, dem der Prophet Mohammed erlaubte, den Islam oder ihn als Propheten zu verleugnen, war Amar Bin Jassir. Jassir, der ein Freund Mohammeds war, wurde vom Stamm der Quraisch gefangen genommen und als Geisel festgehalten. Als die Quraisch Jassir folterten, verleugnete er Mohammed und den Islam, um freizukommen« (S. 116 ff.).
Was in deutschen Intellektuellenkreisen davon wahrgenommen wird, läßt sich exemplarisch im ›Merkur‹ (Nr. 6/2004) nachlesen. Am stärksten dürfte es die aufgeklärten Muslime bedrücken, die ihre mehr oder weniger gelebte Religion unter dem Gezerre der Schriftauslegung praktizieren müssen. Am liebsten würden sie diejenigen Koranstellen, die unzweideutig gegen die Menschenwürde (der Frauen, Andersgläubigen usw.) verstoßen, ungehört und ungelesen machen, doch in den Moscheen wird strenggläubig gepredigt.
Vom 1. Dezember 2004
Telepathogene Dauervisagen
Persönlichkeitsmanagement im idolatrischen Fernsehzeitalter –
Immer die gleichen Gesichter, die täglich in Millionen von Wohnzimmern hineinschaukeln, nein, zwangsverordnet werden, denn man kann ihnen selbst beim Programmhüpfen nicht ausweichen. Ihre Gesichter sind längst zu Visagen degeneriert, zu hautfaltigen Landkarten in Großaufnahme, zu aufmaskierten Mentalitätsträgern, zu Stereotypen fernsehköchelnder Langeweile. Es mögen um die zweihundert Visagisten sein, die sich seit Jahr und Tag öffentlich vorführen lassen, munter daherplappernde Sprechfiguren aus Politik und den Medien, aus dem Unterhaltungszirkus und aus den Verbänden, dazu einige Versprengte aus den Wissenschaften und Künsten. Unsäglich ihre langweilige Dauerpräsenz, weiß man doch schon, was sie von sich geben werden, ehe sie den Mund aufmachen. Sie haben es ja schon hundertmal gesagt, immer dasselbe, ja häufig das Wortgleiche.
Die tägliche telepathogene Vorführung halten die Visagisten für nutzbringende Persönlichkeitspflege, wohingegen der ausgeleierte TV-Betrieb mit dieser Maskerade einen Beitrag zur informellen Grundversorgung zu leisten glaubt. Wozu sonst die Zwangsgebühren für die Öffentlich-Rechtlichen, die ihre Abrufkartei mit behördlicher Bequemlichkeit durchspielen. Es prandelt und blümelt, daß es nur so dröhnt im telestereotypen Wortgetöse. Pathogen: krankheitserregend, weil idolatrisch. TV-Idole liegen einem demokratischen Gemeinwesen wie Steine im Magen.
Wer wirklich was zu sagen hätte, verbirgt sein Gesicht vor dem geistlosen Fernsehbetrieb. Mit den Namen Karl Heinz Bohrer oder Michael Theuinissen z.B. verbindet man kein bekanntes Fernsehgesicht. Dezenz und Geist sind eben knappe Güter in der Hoppelepoche um sich kreisender Quotenbetreiber.
Vom 20. Oktober 2004
Deutsche werden sich zunehmend fremd
Dieser Befund ergibt sich unschwer aus der zugespitzten Identitätskrise in den letzten Jahren. Die Nachkriegsgenerationen bezogen ihr Selbstbild aus einem ungewöhnlichen wirtschaftlichen Erfolg. Das erlaubte es der politischen Klasse, nach außen Deutschland mit dem Scheckbuch von den Realitäten weitgehend fernzuhalten und im Innern das Volk mit sozialstaatlicher Rundumversorgung einzulullen. Zu den Realitäten, die nun mit Wucht über Deutschland hereinbrechen, gehören nationale und persönliche Risiken. Erstmals erleben die Deutschen, daß Globalisierung zwar der Mehrheit Vorteile bringt, eine beträchtliche Minderheit aber auch arbeitslos machen kann und selbst Traditionsunternehmen zum Verschwinden bringt, und zwar deshalb, weil der wuchernde Steuer-, Sozial- und Tarifstaat sich verrechnet, d.h. die wirtschaftlichen Realitäten falsch einschätzt: Zu überdreht ist die Steuerschraube, zu lähmend sind die bürokratischen Fesselungen, zu hoch (im internationalen Vergleich) die Löhne, zu luxuriös der Freizeit- und Urlaubsstil, zu üppig die Sozialleistungen, zu meritorisch das Bildungssystem usw. Da das alles unhaltbar geworden ist, blicken die Deutschen erschrocken in ihren zerbrochenen Wirtschaftsspiegel und bemerken spät, daß sie etwas versäumt haben: nämlich ihre Identität auch kulturell, gesellschaftlich-sozial und auch ›mythos‹-haft zu verwurzeln. Nimmt man die Erschütterungen der europäischen Identität hinzu (durch die mögliche Aufnahme der Türkei in die EU; durch das volksfernes Brüsselregiment usw.), so fühlen sich die Deutschen zunehmend fremd im eigenen Land, erst recht in Europa. Ihrer politischen Klasse bringt sie kaum noch Vertrauen entgegen (vgl. sinkende Wahlbeteiligungen u.a.m.). Auch anderen Orientierungsmächten (Kirche, Verbände, Medien usw.) trauen sie wenig zu. Schon die kleinsten Ansätze einer aufmunternden Selbstwertendeckung sehen sie flugs vergangenheitstrübe eingeschwärzt. Was sollen sie schon mit einem Vaterland anfangen, dessen Wirtschaft dauerhafte Massenarbeitslosigkeit produziert, dessen Muttersprache zunehmend verdenglischt wird, dessen politische Klasse sich den Staat teilweise zur Beute gemacht hat und dessen Identität (nach dem Willen eines einst turnschuhbewehrten, heute weltpolitisch agierenden Ministers) vornehmlich im Holocaustbild verwurzelt sein soll, einer Grundeinfärbung aller Gedanken und Gefühle also, die nach den ›Gesetzen‹ der Psychoanalyse unaufhaltsam in eine nationale Psychose führt und in Dauerdepressionen schon geführt hat? Wer nur hat ein Interesse am nachhaltigen Patientenstatus der Deutschen?